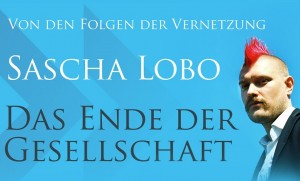von Sonja Sartor
Einen Blick nach Frankreich zu werfen, lohnt sich. Diese Artikelreihe hat in den letzten Wochen versucht, an einzelnen Aspekten die Vielfalt der französischen Medienlandschaft widerzuspiegeln und dabei auch Themen zu betrachten, die man aus der deutschen Tagespresse weniger kennt. Wir blicken zurück auf die fabelhafte Welt der Medienperspektiven à la française.
Frankreich im Fokus
Die Artikelreihe begann mit zwei großen Medienevents: Die Filmfestspiele von Cannes zeigen jedes Jahr im Mai, das Frankreich immer noch zu den großen Playern der Cineastik gehört. Die Bedeutung des Festivals für das Autorenkino ist immens und die goldene Palme kann als wichtigster Filmpreis nach dem Oscar gesehen werden. In Cannes wird nicht nur bereits gefilmtes Material geehrt, sondern den Weg für die Filme von morgen geebnet.
Der medial weltweit verfolgte Eurovision Song Contest verbreitete Hoffnung in dem von Terror gebeutelten Land. Frankreichs Kandidat Amir landete unter den Top Ten und gab seiner Heimat ein Stück des Nationalstolzes zurück.
Frankreich auf der Leinwand
 Vom französischen Volk anerkannt und verehrt ist nicht nur Amir, sondern vor allem einer der großen Charakterspieler der Grande Nation: Gérard Depardieu. Er kann auf ein turbulentes Leben und herausragende Schauspielleistungen in jeglichen Rollen und Filmgenres zurückblicken. Dass er privat öfters über die Stränge geschlagen hat, wird ihm angesichts des Ruhms, den er über die französischen Grenzen hinaus trägt, großzügig verziehen. Bleibt nur zu hoffen, dass der hünenhafte Tausendsassa mit der sanften Stimme uns noch lange mit neuen Filmen oder Fernsehserien beschenken kann.
Vom französischen Volk anerkannt und verehrt ist nicht nur Amir, sondern vor allem einer der großen Charakterspieler der Grande Nation: Gérard Depardieu. Er kann auf ein turbulentes Leben und herausragende Schauspielleistungen in jeglichen Rollen und Filmgenres zurückblicken. Dass er privat öfters über die Stränge geschlagen hat, wird ihm angesichts des Ruhms, den er über die französischen Grenzen hinaus trägt, großzügig verziehen. Bleibt nur zu hoffen, dass der hünenhafte Tausendsassa mit der sanften Stimme uns noch lange mit neuen Filmen oder Fernsehserien beschenken kann.
In einer kleinen Rückschau wurden die Tabubrüche analysiert, die für das französische Kino so typisch sind. Jean-Jacques Beineix‘ Betty Blue – 37,2 Grad am Morgen (1986) stellte sich als Meisterwerk des Cinéma du look heraus, das dem Zuschauer so eindringlich wie kaum ein anderer Film vor Augen führt, welche extremen Wege ein Liebespaar gehen kann, von dem eine Person an einer ausgeprägten Persönlichkeitsstörung leidet. Der Kontrast zwischen den impulsiven, wutgeladenen und den zärtlichen, zerbrechlichen Momenten Bettys zeugt von großer Filmkunst.
Frankreich hat jedoch auch aktuell interessante und einzigartige Filme anzubieten: In einer Kritik wurde der Dokumentarfilm Tomorrow – die Welt ist voller Lösungen unter die Lupe genommen. Filmemacher Mélanie Laurent und Cyril Dion stellen darin kreative Konzepte vor, die sich gegen den prognostizierten Zusammenbruch der Zivilisation stellen und dazu anregen, selbst Hand anzulegen, damit die Kinder von morgen in einer genauso gut oder sogar besser funktionierenden Welt leben können. Der Film ist ein gelungener Gegenentwurf zu Horrorszenarien rund um den Weltuntergang und ist nicht nur unterhaltend, sondern spendet auch viel Hoffnung, was die Zukunft dieser Erde betrifft.
Frankreich streitet, leidet und steht wieder auf
Weiter ging es mit einem Exkurs zur Debatte rund um das Gesetz Loi Evin. Es setzt seit 1991 relativ strenge Maßstäbe zu Werbung für Alkohol und Tabak. Jedoch ist es französischen Abgeordneten gelungen, das Gesetz im Herbst 2015 aufzuweichen. Wo Medien vorher in Beiträgen aus Vorsicht vor keinen Bezug zu Alkohol erwähnten, ist es jetzt legal, über Wein und andere alkoholische Getränke zu „informieren“. Diese Gesetzesänderung soll den Weintourismus und damit die ins Schwanken geratene französische Wirtschaft fördern. Mitunter zeigt die Debatte, dass Wein trotz aller Warnungen seitens gesundheitlicher Behörden zum französischen Leben dazugehört.
Der Artikel über französische Internettrends räumte mit dem Vorurteil auf, dass Franzosen arrogant sind und nicht über sich selbst lachen können. Anhand der Erfolgs-Webseite Viedemerde.fr wurde festgestellt, dass Internetnutzer heute die peinlichen und frustrierenden Aufreger des Tages mit Tausenden von Leuten teilen, die man früher nur dem engsten Freundeskreis erzählt hätte.
Über ein Jahr nach dem Terroranschlag auf Charlie Hebdo war es Zeit, den Status quo von französischer Satire aufzuarbeiten. Basierend auf einer langen Tradition von Karikaturen und Pamphleten, die bis in die Aufklärung zurückreicht, hat sich in Frankreich eine besonders scharfzüngige Satire ausgebildet. Kein Blatt vor den Mund nehmen, Problematiken überspitzen und Persönlichkeiten und Institutionen lächerlich machen – dies ist essenziell für die funktionierende Demokratie der französischen Republik. Charlie Hebdo hat durch das Attentat Kollegen und damit viel künstlerisches Potenzial verloren und versucht heute, eindeutigere Botschaften zu vermitteln. Aufgeben ist keine Lösung: Frankreich bleibt Charlie.
Abschließend ist zu betonen, dass diese Artikelreihe keinen Anspruch auf die vollständige Abbildung der französischen Medienlandschaft gelegt hat. Ziel war es vielmehr, den Lesern von media-bubble.de einen Einblick in interessante und wichtige französische Medienthematiken zu geben. Frankreich und Deutschland lassen sich im Hinblick auf Medien nur schwer vergleichen. Jede Medienlandschaft ist einzigartig. Einzigartig ist an der französischen Medienlandschaft die große Rolle, die Satire einnimmt. In Zeiten der permanenten Terrorangst ist es bewundernswert, welch standfeste Haltung Frankreich einnimmt, die sich auch in den Medien widerspiegelt. Im Kino hat Frankreich immer wieder neue Maßstäbe gesetzt, Filmgeschichte geschrieben und bringt auch aktuell mit neuen Konzepten frischen Wind in die Kinosäle. Internettrends zeigen, dass sich das französische Volk nicht den Humor und vor allem die Lust am Leben nimmt. Medien aus Frankreich sind besonders und vielfältig – und es wird sich auch in Zukunft lohnen, ab und zu in die französische Medienwelt einzutauchen.
Fotos: Pixabay.com , flickr.com/Becky Lai (CC BY-NC-ND 2.0)
Alle Artikel dieser Reihe:
Wenn Leid zu Glück wird – Der Eurovision Song Contest 2016
Die Crème de la Crème des Autorenkinos
Gérard Depardieu: „Es hat sich so ergeben“
Ein bisschen Wein muss sein
Filmkritik: Tomorrow – die Welt ist voller Lösungen
Frankreich bleibt Charlie
Der Tabubruch im französischen Film
Französische Webtrends: Mit Humor geht’s besser