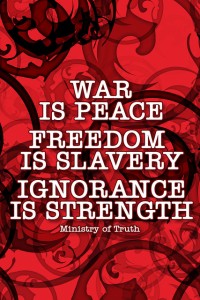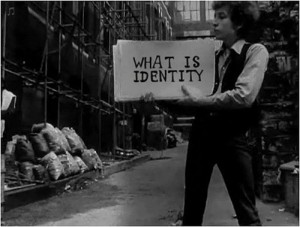Facebook gegen Überschriften-Hijacking
Von Roman van Genabith
Es ist einfach zu verlockend: Ein Klick auf die Überschrift einer Meldung erlaubt es Seitenbetreibern einer Meldung anderer Medien einen ganz eigenen Spin zu verleihen. Doch wird diese Funktion allzu häufig in nahezu propagandistischer Weise missbraucht. Facebook möchte nun dagegen vorgehen.
Seit Mitte vergangenen Jahres kann man verstärkt beobachten, wie Facebook-Seitenbetreiber, vorzugsweise bei gesellschaftlich kontroversen Thematiken wie der Flüchtlingskrise, Meldungen von Nachrichtenportalen unter veränderten Überschriften auf ihren Seiten teilten, die deren Inhalt stark verzerrt zusammenfassen oder gänzlich falsche Aussagen implizieren.
Beispiel hierfür ist die Überschrift „Regiobahn führt Frauenabteile ein, wegen Übergriffe durch Flüchtlinge“ der Gruppe „Deutschland DECKT AUF“, die sich eine Meldung des Handelsblattes zueigen machte, unnötig zu sagen, in welchem Teil des politischen Spektrums die Seitenbetreiber einzuordnen sind.
Alle nachfolgenden Versuche der Handelsblatt-Social Media-Redaktion den Sachverhalt richtig zu stellen, blieben wirkungslos, wurden von den Admins der Gruppe gebremst und blockiert, abgesehen davon, dass deren Teilnehmer das Konzept der sogenannten Filterblase vermutlich so formelhaft abbilden, wie eine These nur belegt werden kann. Viele Medienhäuser und News-Publisher haben mit dieser Problematik zu kämpfen. In vielen Fällen kamen manipulierte Überschriften aus dem rechten Spektrum, bei politischen Themen ist dieses Mittel besonders populär, um die eigenen Fans bei der Stange zu halten und weiter anzuheizen, aber natürlich ist auch das schlichte Streben nach mehr Reichweite ein Motiv.
Entschärfung geplant
Wie Facebook unter anderem Spiegel Online mitteilte, arbeite es unter Hochdruck an einer Entschärfung der Problematik: Nur noch die redaktionseigenen Facebook-Seiten sollen künftig Meldungsüberschriften editieren können. Seitdem die Zahl latent bzw. eindeutig volksverhetzender Beiträge auf der Plattform explodiert und das Netzwerk lange Zeit tatenlos blieb, steht das Unternehmen in Deutschland ohnehin unter Druck und der nun angekündigte Schritt ist gleich in mehrfacher Hinsicht notwendig:
Einerseits ist Facebook ein Sammelbecken, in dem Inhalte journalistischer Medien, Beiträge pseudo- bzw. „alternativer“ Medienportale und persönliche Meinungsäußerungen und Diskussionsbeiträge zusammenfließen. In dieser wild brodelnden Hexenküche ist es für viele Nutzer ziemlich schnell ziemlich egal, woher eine Meldung ursprünglich kam oder wer im weiteren Verlauf auf welche Weise darauf einwirkte. Sie ziehen die Bestätigung für ihre eigenen Ansichten aus Posts, deren verlinkte Quelle sie oft gar nicht lesen.
Andere stoßen unter Umständen auf eine skandalisierte Headline, die von Spiegel Online oder Stern zu stammen scheint und schreiben diesen Medien womöglich eine extreme Position zu, die sie nie vertreten haben. Das ist der Aspekt, der etablierten Medien direkt schadet, deren Arbeit seit Ausbruch der Lügenpresse-Angriffigkeiten ohnehin immer unerquicklicher geworden ist. Es ist also sinnvoll dafür zu sorgen, dass nur die tatsächlichen Urheber einer Meldung deren Ausspielung gestalten dürfen.
Gezielte Social-Media-Adressierung legitimes redaktionelles Mittel
Diese Praxis der Content-Piraterie ist allerdings deutlich von der gezielten Differenzierung der Social-Media-Outputs durch Autoren oder Community Manager einer Redaktion abzugrenzen.
Verschiedene soziale Medien weisen deutlich verschiedene Nutzergemeinden auf. Facebook-Nutzer sind eine sehr heterogene Gruppe, bei Twitter kann die Kenntnis relevanter Hashtags hilfreich sein. Ein regionales Nachrichtenangebot kann unter Umständen gut daran tun, einen Artikel über Facebook, Twitter und eventuell auch Google Plus mit jeweils eigenen Überschriften, Teaser-Texten / Bildern oder Veröffentlichungszeiten auszuspielen.
Foto: flickr.com/Sarah Marshall (CC BY 2.0)
* Erschien zuerst auf mobiFlip.de (18.04.2016)