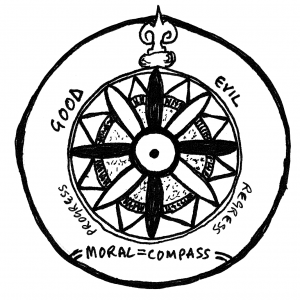Von Roman van Genabith
Der Film The Martian – (deutscher Titel „Der Marsianer – Rettet Mark Watney“) nach dem Drehbuch von Drew Goddard und unter Regie von Ridley Scott, versucht in 144 Minuten einen Roman von rund 500 Seiten wiederzugeben; einen komplexen Plott, der eine komplexe Thematik behandelt.
Kann das gelingen?
Die Kollegen von raumfahrer.net betrachten das Werk mit Blick auf die Tradition der Mars-Filme. Im Folgenden sollen in einer vergleichenden Betrachtung von Buchvorlage und Film die erzählerischen Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Buchvorlage und Film beleuchtet werden. Die Romanvorlage ist Reelle Science-Fiction auf Tuchfühlung zum heute Möglichen, etwa vergleichbar mit GRAVITY (2013). Bleibt dieser Umstand im Film bestehen? Abschließend wird noch kurz auf verschiedene interessante crossmediale Vertiefungen und Anschlussveröffentlichungen eingegangen.
Was passiert?
 Während einer auf 30 Tage angelegten Mars-Expedition kommt es zu einem heftigen Sandsturm, während die Besatzung gerade dabei ist Bodenproben zu sammeln. Die Kommandantin beschließt die Mission abzubrechen und mit dem Rückkehrmodul (MRM) zu starten, das bei weiter steigenden Windgeschwindigkeiten zu kippen und die Crew somit zum Tode auf dem Mars zu verurteilen droht. Doch auf dem Weg zum Rückkehrmodul wird der Botaniker Mark Watney von umherwirbelnden Trümmern der Antennenanlage getroffen und vom Team getrennt. Dabei wird sein Biomonitor zerstört und seine Kameraden halten ihn für tot. Schließlich sind sie gezwungen zu starten, um nicht selbst getötet zu werden.
Während einer auf 30 Tage angelegten Mars-Expedition kommt es zu einem heftigen Sandsturm, während die Besatzung gerade dabei ist Bodenproben zu sammeln. Die Kommandantin beschließt die Mission abzubrechen und mit dem Rückkehrmodul (MRM) zu starten, das bei weiter steigenden Windgeschwindigkeiten zu kippen und die Crew somit zum Tode auf dem Mars zu verurteilen droht. Doch auf dem Weg zum Rückkehrmodul wird der Botaniker Mark Watney von umherwirbelnden Trümmern der Antennenanlage getroffen und vom Team getrennt. Dabei wird sein Biomonitor zerstört und seine Kameraden halten ihn für tot. Schließlich sind sie gezwungen zu starten, um nicht selbst getötet zu werden.
Die Geschichte entwickelt sich fortan um den widererwarten nicht ums Leben gekommenen Mark Watney, sowie die Vertreter der Raumfahrtorganisationen und die mediale Öffentlichkeit auf der Erde, die mit der unerwarteten Tragödie umgehen müssen.
Rascher Fortschritt
Schon früh zeigt sich, dass die Filmcrew versucht sich möglichst an der Romanvorlage zu orientieren und dabei auch auf Details achtet. So versucht der Pilot der Mission durch Zündung der Steuerdüsen das Rückkehrmodul zu stabilisieren, als Dieses zu kippen droht und erklärt das auch. Diskrepanzen ergeben sich vor Allem im Tempo. Während der Roman in ausgedehnten Passagen und unter Nutzung verschiedener Zeitsprünge die Zeit nach dem unglücklichen Aufbruch der Crew und die ersten Tage und Wochen danach schildert, ohne dabei anstrengende Längen zu entwickeln, ergibt sich im Film ein gefühlt recht rascher Handlungsfortschritt. Nachdem Mark, vom Antennenstück aufgespießt und in Folge starkem Druckverlusts schon ohnmächtig, durch den Sauerstoffalarm seines Expeditionsanzugs wieder zu sich kommt, wird sein Überlebenskampf und die Rückkehr in die Wohnkuppel recht ausführlich und anschaulich gezeigt. Die Romanvorlage geht hier sehr detailreich auf die Funktion der Anzüge und die Umstände, die Marks sofortigen Tod in dieser Situation verhindern ein, während der Protagonist im Film nach einer eindrücklichen „Operation“ an sich selbst knapp erläutert, dass das verdickte Blut ein weiteres Entweichen von Anzugluft verhinderte.
In beiden Fällen wird Mark zum einsamen, aber selten verzweifelten oder tragischen Helden. Während er im Roman recht lange davon überzeugt ist unausweichlich sterben zu müssen, ohne dass dadurch spürbare Verbitterung aufkommt, wirkt es im Film oft wie ein gefährliches, aber letztlich doch fantastisches Abenteuer, ein Road-Movie in ungewohnter Umgebung. Das mag einerseits über den wahren Ernst von Marks Lage hinwegtäuschen, spiegelt aber auch die ungeheure Improvisationsgabe und den eisernen Lebenswillen realer Astronauten wieder.
Die rettenden Kartoffeln, die Mark Watney in beiden Versionen pflanzt und so sein mehrjähriges Überleben auf dem Mars sichert, findet er im Buch erst relativ spät in Form einer Thanksgiving-Überraschung im Missionsgepäck, im regulären Proviant befindet sich nichts biologisch aktives. Im Film tauchen sie dagegen einfach auf, und zwar recht bald nachdem Mark Inventur gemacht hat. Während ihm, ein ordnungsgemäßes Funktionieren der autarken Lebenserhaltung der Station, die nur für 31 Tage konzipiert wurde vorausgesetzt, Luft und Wasser nahezu unbegrenzt zur Verfügung stehen, verhungert er, wenn er keine eigene Nahrung erzeugen kann. Allerdings bleibt ihm, bedingt durch die drastisch gesunkene Anzahl an Stationsbewohnern, ein komfortabler Zeitvorrat. Dieser Umstand ermöglicht es Buch und Film die Handlung nicht als hektischen Wettlauf gegen die Uhr darzustellen.
Unterschiede im Detail
 Mark pflanzt Kartoffeln. Dafür muss er Ackerland urbar machen und benötigt somit Erde. In beiden Versionen holt er Mars-Erde in die Wohnkuppel, ein extrem aufwendiger, Zeit- und Kräftezehrender Prozess. Die häufigen Außeneinsätze verschleißen zudem die Raumanzüge. Deren hat er zwar jetzt Mehrere, trotzdem macht ihm die unumkehrbare Verschmutzung der CO2-Filter im Buch Sorgen. Im Film verläuft diese Phase relativ zügig. Eine gewisse Simplifizierung ist auch zu beobachten, als der Film nicht auf die genaue Prozedur der Erzeugung von Wasser eingeht, das Mark für seine Kartoffelfarm in weit größeren Mengen, als ihm zur Verfügung stehen, benötigt. Die Elektrolytische Reaktion und die durch Marks Unaufmerksamkeit ausgelöste heftige Explosion werden gezeigt, die Notwendigkeit den Sauerstoffanteil im Habitat durch eine komplette Stickstoffatmosphäre zu ersetzen, inklusive des nicht trivialen Kunststücks dies gegen die Lebenserhaltenden Routinen der Elektronik hinzubekommen, entfallen.
Mark pflanzt Kartoffeln. Dafür muss er Ackerland urbar machen und benötigt somit Erde. In beiden Versionen holt er Mars-Erde in die Wohnkuppel, ein extrem aufwendiger, Zeit- und Kräftezehrender Prozess. Die häufigen Außeneinsätze verschleißen zudem die Raumanzüge. Deren hat er zwar jetzt Mehrere, trotzdem macht ihm die unumkehrbare Verschmutzung der CO2-Filter im Buch Sorgen. Im Film verläuft diese Phase relativ zügig. Eine gewisse Simplifizierung ist auch zu beobachten, als der Film nicht auf die genaue Prozedur der Erzeugung von Wasser eingeht, das Mark für seine Kartoffelfarm in weit größeren Mengen, als ihm zur Verfügung stehen, benötigt. Die Elektrolytische Reaktion und die durch Marks Unaufmerksamkeit ausgelöste heftige Explosion werden gezeigt, die Notwendigkeit den Sauerstoffanteil im Habitat durch eine komplette Stickstoffatmosphäre zu ersetzen, inklusive des nicht trivialen Kunststücks dies gegen die Lebenserhaltenden Routinen der Elektronik hinzubekommen, entfallen.
Solche Ungenauigkeiten und Vereinfachungen treten immer wieder auf. So verfügt Mark im Buch über zwei funktionierende Rover mit eigener Druckbeaufschlagung, im Film ist es nur noch einer. Dennoch benötigt er für den später notwendigen langen Weg zum Landeplatz der Nachfolgemission im Grunde deren zwei. Mark braucht den zusätzlichen Platz, um dort die Luft- und Wasseraufbereiter unterzubringen, die er zuvor aus der Basis ausbaut. Auch darauf geht der Film nicht ein, obwohl es eine Kernnotwendigkeit für Marks Lebensentscheidende Reise zum Ares IV Landeplatz ist. Schließlich hat Mark eine Art Anhänger für seinen funktionierenden Rover. Als Mark die Pathfinder-Sonde, die 1997 auf dem Mars landete und rasch verstummte, birgt und als Kommunikationsrelay verwendet, wird der im Buch höchst umständliche und herausfordernde Transport der Sonde, als auch deren Unterbringung außen an der Wohnkuppel, deutlich zügiger und glatter durchgebracht.
Diese Simplifizierung zeigt sich besonders krass bei dem Unfall, der die Wohnkuppel dekomprimiert und Marks Kartoffelfarm zerstört. Mark, der gerade die Kuppel verlassen möchte, wird durch die explosive Dekompression hinweggeschleudert, als die Luftschleuse, die er benutzt, aufgrund von Materialermüdung explodiert. Dabei wird in Buch und Film Marks Raumanzug und Helmvisier schwer beschädigt. Im Buch dauert diese Krise für Mark viele Stunden, während denen er im Inneren der dutzende Meter weggeschleuderten Schleuse zwar noch am Leben ist, da der Innendruck noch stabil ist, durch den zerstörten Helm aber zunächst keine Chance hat einen der Rover zu erreichen, die nach dem Verlust der Wohnkuppel seine letzte Chance sind. Sich und seine Schleusenkammer mit akrobatischen Kunststücken zurück zur Wohnkuppel zu rollen, dort unter den Trümmern einen intakten Raumanzug zu finden, nachdem sein Eigener nur äußerst notdürftig und für wenige Minuten zu flicken war, und schließlich einen Rover zu erreichen, um dann den Wiederaufbau der Kuppel zu planen, ist im Buch eine sehr ausgedehnte Episode und wird im Film zwar dramatisch, aber zügig abgehandelt.
Eine weitere, für Mark lebensbedrohliche Krise, entfällt im Film vollständig. Auf seiner über 3000 km langen Reise zum rettenden Fluchtschiff gerät er in einen marsianischen Staubsturm. Anders als die heftigen Sandstürme zu Beginn ist dieses Phänomen zwar für die beobachtenden NASA-Forscher auf den Satellitenbildern klar erkennbar, zeigt sich Mark aber zunächst nicht. Der Effekt wird lediglich in einem langsamen, aber stetigen Verlust an Arbeitsleistung spürbar, die Marks aus der Wohnkuppel ausgebaute Solarpanele erbringen. Das wird durch die sinkende Lichtdurchlässigkeit der Atmosphäre bewirkt und als Mark die richtigen Schlüsse zieht, ist er bereits mehrere Tage in die Ausläufer des Phänomens eingetaucht und es ist im Grunde zu spät für ihn es zu umfahren oder umzukehren. Dennoch findet er einen Weg. Dieser ist zwar nachvollziehbar, zugegebenermaßen aber nur schwer filmisch darstellbar. Diese Episode ist im Buch eine ausgedehnte Krise, die sich viele Tage hinzieht und weniger durch sichtbare Action, als durch analytisches und planvolles Handeln entschärft wird.
Deutliche Diskrepanzen zu Gunsten filmischer Dramatik sind bei der Rettung Marks durch die Hermes, das interplanetare Raumschiff, mit dem die Astronauten des Ares-Programms zwischen Mars und Erde pendeln, zu konstatieren. Während die Demontage des Rückkehrmoduls der Ares IV zwecks Gewichtsersparnis, um einen höheren Orbit erreichen zu können, glaubhaft abläuft und der Film auch beim Start, dem Anpassen von Abfanggeschwindigkeit und Distanz nah am Buch bleibt, weicht er ab, als die Distanz am Ende trotz aller Bemühungen zu groß ist, um Mark einzusammeln. Während das Buch hier eine kühne Idee Marks erwähnt, bei der er seinen Anzug aufschneidet und durch ausströmende Luft am Handschuh Diesen als Schub- und Steuerdüse verwenden möchte, diese Idee von aber der Kommandantin verworfen wird, greift er im Film darauf zurück. Auch geht die Kommandantin statt des Arztes Chris Beck nach draußen, um Mark zu holen. Eine eher zweifelhafte Änderung, da Beck bereits in Position und Zeit ein kritischer Faktor ist.
Gemeinsamkeiten
Obwohl das Drehbuch hier und da vom Roman abweicht und Manches vereinfacht, bleibt es bei Vielem auch nah am Original. So sind zahlreiche Dialogstellen, etwa in Marks Videolog, das in Film und Buch eine zentrale Erzählkomponente darstellt, fast Wortgetreu übernommen worden. Die vertrackten Umstände, durch die die erste Sonde mit Versorgungsgütern in brennenden Trümmern ins Meer stürzte, werden nachvollziehbar präsentiert. Auch der teils extreme Zeitversatz, bedingt durch die doppelten Signallaufzeiten der Botschaften zwischen Mars und Erde, werden akkurat übernommen. Die Gesamtstimmung im Buch findet der Zuschauer im Film ebenfalls wieder. Auf überzogene Dramatik und Emotionalität wird weitgehend verzichtet. Es dominiert fast durchgängig ein Klima zurückhaltender Hoffnung, durchsetzt mit trockenem, aber nicht bitterem Humor.
Interessant: Trotz Beteiligung Chinas, dessen Verhältnis zur westlichen Welt traditionell gespannt ist, schaffen es Buch und Film politische Ränkespiele minimal zu halten. Zu keinem Zeitpunkt wird von einem der beteiligten Akteure erwogen den Einsamen vom Mars einer knappen Budgetpolitik zu opfern. Viel mehr fiebert am Ende die ganze Welt dem Ausgang der riskanten Aktion entgegen, was sich sehr treffend im Untertitel der deutschen Synchronisierung des Films widerspiegelt: Rettet Mark Watney. Hier hat das filmische Medium einen Vorteil: Die gespannt wartenden Massen, die sich rund um die Welt versammeln, um den Übertragungen der Fernsehstationen zu folgen, können ins Bild gebracht werden.
Ein spezieller Unterschied zum Buch ergibt sich über dies zum Schluss. Während häufig Filme nach der finalen Schlusskrise und der Erfüllung, oder dem Tod Aller, zu Ende sind und Bücher noch einen Epilog aufweisen, ist es hier anders herum. Das Buch endet mit der Rettung Marks im Orbit des Mars. Im Film wird er als Lehrer für Astronautenanwerter gezeigt, den Abschluss bildet der Start einer weiteren bemannten Mission des Raumfahrtprogramms; eine schöne Botschaft: Die Reise geht weiter.
Implikationen
Der Marsianer ist Real-Science-Fiction, die sich in weiten Teilen an existierender Technologie und Organisationsstrukturen orientiert. Die Mission liegt wenige Jahrzehnte in der Zukunft. Sie greift zum Teil auf Technologie zurück, die noch nicht gebaut wurde, die aber in der Theorie plausibel durchgerechnet und machbar ist. Im Speziellen zu nennen ist hier das interplanetare Raumschiff, das in dieser Form mit Nuklearer Energieversorgung, Ionenantrieb und durch Rotation erzeugter künstlicher Schwerkraft zwar denkbar ist, jedoch noch nie gebaut wurde.
Kritiker vergleichen den Film mit dem SF-Blockbuster Interstellar, doch auf den zweiten Blick greift dieser Vergleich nicht. Einerseits kommt Der Marsianer ohne die Notwendigkeit zur Brechung physikalischer Gesetze aus, durch den einfachen Umstand, dass eine zentrale Zutat der meisten Science-Fictionwerke, Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit, hier nicht vorkommt. Warpantriebe oder Wurmloch, obgleich Bestandteil zahlreicher großartiger Filme und Serien, sind hier nicht nötig, um eine spannungsgeladene, aber weitgehend realistische Handlung zu schaffen. Auch gibt es bei Der Marsianer nicht den Bruch, den viele Filme dieses Genres im letzten Drittel ihrer Laufzeit aufweisen. Ein Solcher bleibt auch bei Interstellar nicht aus, dessen Plot gegen Ende zunehmend ins Absurde abgleitet und nicht mehr nachvollziehbar ist.
Fazit
Auch ein anderes viel bemühtes Klischee speziell der Mars-Filme kann Der Marsianer vermeiden: Es ist auf absehbare Zeit weder wünschenswert, noch angestrebt, dauerhafte Kolonien auf dem Mars oder einem anderen Himmelskörper im Sonnensystem zu errichten. Während die Initiative Mars One einen Plan zur Gründung von Mars-Kolonien betreibt, zeigt das vorliegende verfilmte Buch eindeutig die Unsinnigkeit dieser Idee. Der Mars ist wissenschaftlich ein spannendes Ziel für Generationen, das rechtfertigt dessen Erforschung, vielleicht zukünftig auch unter Beteiligung von Menschen. Aber seine Umwelt ist beinahe so tödlich wie der Weltraum. Und auch Mark Watney ist die ganze Zeit des Films über bestrebt zu seiner Heimat zurückzukehren. Er ist somit ein Terraner.
Crossmediale Rezeption
Der Film, der überwiegend wohlwollende bis eindeutig positive Kritiken erhalten hat, brachte inzwischen einige intermediale Ergänzungen hervor. So veröffentlichten verschiedene Raumfahrtagenturen, darunter das zur ESA gehörende Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Aufnahmen, die Handlungsorte des Films auf Basis von Aufnahmen zeigen, die heutige Mars-Sonden geliefert haben. Dazu zählt unter anderem ein Überflugvideo, das von deutschen Planetenforschern erstellt wurde und Marks Weg von seiner Wohnkuppel zum Landeplatz der Nachfolgemission zeigt, wo er sein Rettungsgefährt besteigt. Der Mars wirkt in diesem Video noch ein Stück unfreundlicher, viele Felsen, weniger Sand, weniger rot. Kein Ort zum Bleiben.
In einem für iPhone- und iPad erschienen Spiel müsst ihr Mark am Leben halten und durch seine Mission führen. Der Marsianer profitiert von Handlungsorten, die zwar hinter dem irdischen Horizont liegen, aber dennoch nicht aus der Welt sind.
Fotos: © 2015 20th Century of Fox
Roman van Genabith ist freier Journalist und unter Anderem Autor für das Astronomieportal raumfahrer.net. Ferner schreibt er für ein Apple-Magazin und ein ostwestfälisches Nachrichtenangebot.
 Ein solches findet sich beispielsweise in den Hunger Games, in denen Katniss zwar am Ende siegt und zusammen mit Peeta lebt, aber deutliche Traumata von ihrem Kampf zurückbehält. Die Narration der Young Adult Dystopie orientiert sich insgesamt stark am Bildungsroman, einer Gattung, die vor allem Romane aus dem 18. und 19. Jahrhundert bezeichnet, die sich durch einen starken Fokus auf Bildung auszeichnen. In Werken wie „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ von Goethe (1795) wird die Lebensgeschichte eines jungen, zumeist männlichen Protagonisten mit all ihren Irrtümern und Enttäuschungen geschildert. Am Ende steht dabei die Selbstfindung des Helden und dessen Eingliederung in die Gesellschaft. Er muss seinen eigenen Platz in der Welt finden und durchlebt viele Auseinandersetzungen mit Eltern, Arbeitgebern und Freunden. Dieses narrative Muster findet sich auch in vielen Young Adult Dystopien wieder. Nun sind es vor allem weibliche Teenager, die diesen Weg auf sich nehmen und nach ihrem Platz in der Welt suchen. So gibt es auch Dystopien, in denen das Regime gar nicht überworfen werden muss, um den Protagonisten einen Platz zum Leben zu geben. In Holly Blacks Curse Worker Reihe beispielsweise findet Hauptfigur Cassel einen Weg, sich in die dystopische Gesellschaft einzugliedern, anstatt sie zu überwerfen. In der Regel aber muss das System zerstört werden, um den Teenagern ein gutes Leben zu ermöglichen. Mit diesem Muster ist die Dystopie vor allem zu einer Art Fabel des Erwachsenwerdens geworden.
Ein solches findet sich beispielsweise in den Hunger Games, in denen Katniss zwar am Ende siegt und zusammen mit Peeta lebt, aber deutliche Traumata von ihrem Kampf zurückbehält. Die Narration der Young Adult Dystopie orientiert sich insgesamt stark am Bildungsroman, einer Gattung, die vor allem Romane aus dem 18. und 19. Jahrhundert bezeichnet, die sich durch einen starken Fokus auf Bildung auszeichnen. In Werken wie „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ von Goethe (1795) wird die Lebensgeschichte eines jungen, zumeist männlichen Protagonisten mit all ihren Irrtümern und Enttäuschungen geschildert. Am Ende steht dabei die Selbstfindung des Helden und dessen Eingliederung in die Gesellschaft. Er muss seinen eigenen Platz in der Welt finden und durchlebt viele Auseinandersetzungen mit Eltern, Arbeitgebern und Freunden. Dieses narrative Muster findet sich auch in vielen Young Adult Dystopien wieder. Nun sind es vor allem weibliche Teenager, die diesen Weg auf sich nehmen und nach ihrem Platz in der Welt suchen. So gibt es auch Dystopien, in denen das Regime gar nicht überworfen werden muss, um den Protagonisten einen Platz zum Leben zu geben. In Holly Blacks Curse Worker Reihe beispielsweise findet Hauptfigur Cassel einen Weg, sich in die dystopische Gesellschaft einzugliedern, anstatt sie zu überwerfen. In der Regel aber muss das System zerstört werden, um den Teenagern ein gutes Leben zu ermöglichen. Mit diesem Muster ist die Dystopie vor allem zu einer Art Fabel des Erwachsenwerdens geworden.