Schlagwortarchiv für: Musik
2019 – Zahlreiche Beiträge auf Media Bubble
/in Archiv, Medienkritik, Neueste Beiträge/von Ann-Christine StruppHappy Birthday Media Bubble – unser Blog wird 9 Jahre alt! Unsere Redakteur*innen haben sich passend zu diesem Event die für sie besten Beiträge der letzten Jahre herausgesucht – und dabei entdeckten sie: Viele Themen sind auch heute noch sehr relevant! Im Folgenden erfahrt ihr von uns, was im Jahr 2019 in der Welt und auf unserem Blog so los war…
Die Lage der Musikbranche in Zeiten der Krise
/in Medienpraxis, Neueste Beiträge/von Ann-Christine StruppSchon seit mehreren Monaten, besonders zu Beginn der Corona-Krise in Deutschland, bestimmt das Motto ‚Social Distancing‘ das Leben eines jeden von uns. Doch nicht nur unser soziales Miteinander wurde zeitweise sogar zum Stillstand gebracht, sondern auch das kulturelle Leben. Wie die Kulturszene – insbesondere die Musik- und Veranstaltungsbranche – mit den Auswirkungen der Krise umgeht, erfahrt ihr in diesem Beitrag.
Fake-Accounts und der Streamingmarkt
/in Archiv, Medienkritik, Neueste Beiträge/von Ann-Christine StruppDer Musikkonsum über Streamingdienste hat in den letzten Jahren rasant zugenommen. Algorithmen halten das Nutzerverhalten fest und kreieren ein Meinungsbild, das repräsentativ für den Beliebtheitsgrad der Künstler stehen soll. Doch was ist, wenn dieses vermeintliche Meinungsbild, das sich in Form von Clicks äußert, „fake“ ist und aufgrund wirtschaftlicher Zwecke manipuliert wurde?
Online-Streaming: Hier spielt die Musik!
/in Archiv, Medienkritik, Neueste Beiträge/von Ann-Christine StruppMusikstreaming ist spätestens seit der legalen Einführung keine Besonderheit mehr. Das schwedische Unternehmen Spotify hat durch die Einführung von Online-Streaming die Gelegenheit ergriffen, Musik kostenlos oder zu einer niedrigen Leihgebühr anzubieten. Weshalb der Streamingdienst nun auch an der DNA seiner Nutzer interessiert ist und was für Nachteile das Musikstreaming mit sich bringen könnte, erfahrt ihr hier.
YouTube: Eine Chance für Musik-Newcomer
/in Archiv, Medienpraxis, Neueste Beiträge/von Tanja MillerJustin Bieber hat es geschafft – Charlie Puth auch. Die Plattform Youtube ist für viele ein Sprungbrett in eine Musikkarriere. Jedoch nur, wenn die Community das auch möchte.
Das Geschäft mit Social Media: Die Musikbranche passt sich an!
/in Medienkritik, Neueste Beiträge/von Ann-Christine StruppEin Live-Konzert, ein Auftritt im Fernsehen oder im Radio: In der Welt eines Musikers gibt es viele Bühnen, die er betreten mag, doch eine ganz besondere ist in den letzten Jahren hinzugekommen, die des Social Media. Sie verspricht eine exklusivere Nähe zwischen den Künstlern und der Öffentlichkeit, doch scheint dahinter nicht nur ein sozialer Akt zu stehen, sondern eine Marketingstrategie, die für die Musikbranche zum Pflichtprogramm geworden ist.
Wenn Leid zu Glück wird – Der Eurovision Song Contest 2016
/in Archiv/von Redaktionvon Sonja Sartor
Die Halle liegt im Dunkeln. Allein die weißen Lichtpunkte im Publikum lassen einen erahnen, wie viele Menschen sich hier tummeln. Dann erklingt der erste Takt und das Scheinwerferlicht wird auf den Künstler geworfen. Die Menge tobt. Die Flaggen werden wieder freudig geschwenkt.
Am 14. Mai war es wieder soweit: Der Vorjahresgewinner Schweden lud Europa zum 61. Eurovision Song Contest nach Stockholm ein. Aber dieses Jahr war der Wettbewerb noch ein Stück gigantischer, denn zum ersten Mal wurde die Show nach China und in die USA übertragen. So ging ein bunter, friedlicher und mitreißender Song Contest über die Bühne, der für manche Überraschung sorgte. Zusammenfassungen des ESC findet man online zuhauf; media-bubble konzentriert sich gemäß der Reihe „Medienperspektiven à la française“ auf den Auftritt des französischen Kandidaten.
Ein Hoffnungsschimmer für Frankreich
Mit dem ersten Ton scheint der junge Mann in seinem schwarzen Anzug und den weißen Sneakers die Herzen der Zuschauer für sich gewonnen zu haben. Vor 16.000 Zuschauern in der Halle und geschätzten 100 Millionen Zuschauern vor den Fernsehbildschirmen singt er sein Lied, als hätte er nie etwas anderes gemacht. „J’ai cherché“ (dt. Ich habe gesucht) ist ein eingängiger und gute Laune verbreitender Popsong, der perfekt zu seinem Interpreten passt.
Das Lied handelt davon, auf der Suche nach dem richtigen Weg zu sein. Amir, der israelisch-französische Sänger mit dem ansteckenden Dauerlächeln, kennt dieses Gefühl nur zu gut. Dem gelernten Zahnarzt fehlte etwas in seinem Leben. Er wollte morgens mit dem Gedanken aufwachen, dass er in seinem Beruf glücklich ist. Schließlich fand er das, was ihm fehlte und machte die Musik zu seinem Beruf. Dann wurde er 2014 im französischen Format von The Voice bekannt und belegte den dritten Platz.
Seinen musikalischen Höhepunkt hat Amir wohl dieses Jahr mit der Teilnahme am Eurovision Song Contest erreicht. Besonders an „J’ai cherché“ ist, dass es in französischer wie auch englischer Sprache gesungen wird. Bekanntlich ist das französische Volk sehr stolz ist auf die eigene Sprache. Es wundert also nicht, dass sich ein französischer Staatssekretär, zu dessen Aufgabenbereich die Frankophonie zählt, im Vorfeld des Wettbewerbs seiner Empörung über das Lied bei Twitter Luft machte. Es sei „bestürzend und inakzeptabel“, dass ein Lied mit englischem Refrain Frankreich repräsentieren würde, so André Vallini.
Amir, der selbst aus einer multikulturellen Familie stammt, wollte mit der Zweisprachigkeit ein Zeichen setzen: „Die englischen Sätze dienen eigentlich nur dazu, dass die Zuschauer verstehen, was ich singe. Sie ermöglichen, dass wir die Menschen von unserer Botschaft und von unserem Lied überzeugen können.“ Immerhin seien 80 Prozent des Textes französisch. Frankreich möchte ein positives Bild der Grande Nation vermitteln. Es soll zeigen, dass sich das Land trotz all der schrecklichen Ereignisse der letzten Monate nicht unterkriegen lässt und optimistisch in die Zukunft blickt.
Ein schwedischer Milchbubi, eine Australierin auf einer Glitzerkiste und ein emotionales Klagelied
Belgien durfte mit Laura Tesoro, einer jungen Frau mit wildem Lockenkopf und Paillettenkostüm, den Wettbewerb eröffnen. Sie legte mit ihrem Popsong einen gelungenen und energievollen Auftritt hin. Kraftvoll ging es dann auch weiter mit typischen ESC-Momenten: halbnackte Trommler, Sängerinnen in hautengen, funkelnden Abendroben, kuriose Frisuren und verblüffende Lichteffekte. Manche Auftritte wie die des schwedischen Frans, dem lieben Jungen von Nebenan, beeindruckten durch ihre Schlichtheit und Unaufgeregtheit. Australien, zum zweiten Mal vertreten unter den Kandidaten, hatte eine zierliche Frau ins Rennen geschickt. Auf einem glitzernden Kubus performte Dami Im das Lied „Sound of Silence“ und nahm mit ihrer erstaunlich kraftvollen und klaren Stimme die gesamte Halle ein.
 Jamala aus der Ukraine fiel mit ihrem Song „1944“ komplett aus der Reihe. Dramatisch und nahezu jammernd inszenierte sie in diesem traurig-schönen Klagelied die Geschichte von der Vertreibung der Krimtataren. Russland hält das Lied für politisch motiviert und sieht es als Provokation angesichts der Krim-Annexion von 2014. Ob Politikum oder nicht, Jamala schaffte es, die Zuschauer in ihren Bann zu ziehen.
Jamala aus der Ukraine fiel mit ihrem Song „1944“ komplett aus der Reihe. Dramatisch und nahezu jammernd inszenierte sie in diesem traurig-schönen Klagelied die Geschichte von der Vertreibung der Krimtataren. Russland hält das Lied für politisch motiviert und sieht es als Provokation angesichts der Krim-Annexion von 2014. Ob Politikum oder nicht, Jamala schaffte es, die Zuschauer in ihren Bann zu ziehen.
Der deutsche Song schien dagegen mit der Konkurrenz nicht mithalten zu können. Solide und sympathisch, aber mehr leider nicht. Er war eben anders als „Ein bisschen Frieden“, mit dem Nicole 1982 die ESC-Trophäe nach Deutschland geholt hatte. Damals hatte die erst 17-Jährige ihr Lied in sieben Sprachen vorgetragen.
Verstanden zu werden war den meisten Künstlern sichtbar wichtig. Wenige Songs griffen die eigene Landessprache auf, Österreich hatte sich sogar für einen vollständig französischen Song entschieden. Englisch war die Sprache des Abends.
Durch das neue Abstimmungsverfahren, bei dem zuerst die Punkte der Länderjurys und dann der Zuschauer zusammengetragen werden, wurde bewusst Spannung bis zur letzten Minute erzeugt. Australien und die Ukraine lieferten sich ein Kopf-an-Kopfrennen, bis mit der letzten Punktevergabe feststand, dass der Sieg an die Ukraine geht.
Stolzes Frankreich
Auch Amir aus Frankreich hat Grund zu feiern. Er landete mit 257 Punkten auf dem sechsten Platz, was Frankreichs beste Platzierung seit 2002 darstellt. Zwar wartet sein Heimatland seit 1977 auf einen erneuten Sieg, aber der Sänger ist sich nach der Show sicher, dass er mit seinem Auftritt Frankreich ein Stück seines Stolzes zurückgegeben hat.
Fotos: wikimedia.org/Albin Olsson (CC BY-SA 4.0), wikimedia.com/Albin Olson (CC BY-SA 4.0)
Die Queen of blues lebt!
/in Archiv/von RedaktionVon Maya Morlock
Die Dokumentation „Janis – little girl blue“ von Regisseurin Amy J. Berg zeigt das Leben der Blues- und Rocklegende Janis Joplin. Der Zuschauer begleitet sie von der Geburt an in Port Arthur 1943 bis zu ihrem verfrühten Tod im Alter von nur 27 Jahren. Interviews von Familienmitgliedern, Freunden und Bandmitgliedern, persönliche Briefe von Joplin selbst und das authentische Filmmaterial von Liveauftritten und Interviews stellen Joplins Leben und ihre Person lebensnah dar.
Wie sie leibt und lebt
Zu Beginn sieht man die erwachsene Janis Joplin auf der Bühne, an dem Ort, an dem sie sich wohl und sicher fühlt. Im Rampenlicht ist sie jemand. Dort gibt sie alles, dort geht sie völlig auf und lebt jede Note, jedes Wort. Der Text kommt ihr über die Lippen, als sei er ihr gerade erst in den Sinn gekommen, kein bisschen gekünstelt. Sie versprüht eine Energie, die fasziniert, die ansteckt und man erwischt sich beim Mitwippen zum Takt. Schnell ist alles herum vergessen, Joplin schafft es einen mit wenigen Zeilen in den Bann zu ziehen, ihre Präsenz und Ausstrahlung sind ergreifend. Man bewundert dieses energiegeladene Bündel voller Leben und fragt sich: Was ist nur geschehen, was ist so schrecklich schief gelaufen?
Das schwarze Schaf
Joplin ist ein kleiner Streithahn, immer auf Krawall aus. Sie ist ein untypisches Mädchen, keine Schönheit, die man auf einem Modemagazin erwarten würde: Kräftige und nahezu männliche Züge zeichnen ihr Gesicht, an dem struppige Haare, weder glatt noch lockig, herunterhängen. Sie hat kräftige Beine und ist etwas mollig an den Hüften. In der Schule wird sie gemobbt, ihre erste Flucht in die große weite Welt scheitert und ihr Verlobter hintergeht sie. Es ist wohl eine Interpretationssache, doch allein die erste halbe Stunde des Films zeichnet eine tief verletzte Person, die ihr Leben lang nach Anerkennung und Liebe sucht. Immer wieder wird das schon angekratzte Selbstvertrauen zerstört, beispielsweise als die junge Sängerin Joplin zum hässlichsten Mann gewählt wird. Joplin fängt sich, doch Drogen und Alkohol sind ständige Wegbegleiter. Mehrmals versucht sie clean zu werden, doch richtig los kommt sie nie.
„Take another little piece of my heart, baby“
Der Film begleitet sie in ihrer Zeit bei der ersten Band „Big Brother and the Holding Company“ und auch bei ihrem zweiten Projekt „Kozmic Blues“. Die Musik kommt neben dem erstaunlichen Leben Joplins natürlich nicht zu kurz: Liveaufnahmen von zum Beispiel „Piece of my heart“ und auch die Entstehungsgeschichte von Joplins größtem Erfolg „Me and Bobby McGee“ werden gezeigt. Ihre Vorbilder und Inspirationsquellen bekommen Raum; eine Wolke aus Blues, Folk und Rock´n Roll vermischt sich zu einem gigantischen Klangerlebnis.
Do you know Janis?
Viele mosaikartige Einzelteile aus Interviews, dem Filmmaterial und den sehr persönlichen Briefen von Janis an ihre Eltern setzten nach und nach das Puzzle des Lebens und der Person Joplins zusammen. Unglaublich plastisch und sogleich respektvoll schafft es Berg ein facettenreiches Dasein in weniger als zwei Stunden darzustellen. Am Ende hat man das Gefühl Joplin wirklich zu kennen und zu verstehen, als habe man sie tatsächlich getroffen. Unglaublich bewegend ist diese Dokumentation, von der so einige Liebesschnulzen noch etwas lernen könnten – unglaublich authentisch und zuletzt untröstlich traurig.
Eine Hommage an eine wunderschöne Frau mit einem riesigen Talent. Ich wage es kaum zu sagen, doch dieser Film lässt Janis ein Stück weit weiterleben. Sie lebt in den Köpfen der jungen Generation, die sie dadurch wiederentdeckt, bevor sie vergessen werden konnte.
Foto: flickr.com/Winston Vargas (CC BY-NC 2.0)
Katzenjammer auf höchstem Niveau
/in Archiv/von RedaktionVon Maya Morlock
Am 29. Oktober 2015 kommt Xavier Giannolis neuer Film in die Kinos. In der Tragikomödie „Madame Marguerite oder die Kunst der schiefen Töne“, die Madame wird von Catherine Frot (Dinner für Spinner) gespielt, geht es vordergründig um eine Frau, die völlig schief und unrhythmisch singt, doch dies durch die durchweg positive Resonanz ihres Publikums nicht weiß. Doch der Film hat auch eine äußerst verletzliche und sentimentale Seite.
Bis die Ohren bluten
In den 1920er Jahren gibt Marguerite Dumont ein Benefizkonzert für die Kriegswaisen in ihrem kleinen Schloss nahe Paris. Einige begnadete Musiker und Sänger treten auf, zarte und wohlklingende Musikstücke der Klassik sind zu vernehmen. Als Höhepunkt betritt Marguerite die Bühne. Die allseits bekannten Anfangstöne der Arie der „Königin der Nacht“ aus Mozarts Zauberflöte erklingen. Dort besingt die Königin der Nacht die Verstoßung ihrer Tochter Pamina. „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Tod und Verzweiflung“, singt Marguerite, doch leider nicht mit den gewöhnlichen Tönen. Völlig falsch intoniert und schwankend im Rhythmus quält sie sich durch das Stück. Bei dem gefürchteten Hochton und der Koloratur gefriert dem Zuschauer fast das Blut in den Adern, so unerträglich ist der Missklang. Gleichzeitig imponiert die Inbrunst, mit der die Gastgeberin ihr nicht vorhandenes Gesangstalent zur Schau stellt.
Das Publikum ist wenig überrascht, im privaten Klub kennt man die Madame und ihr Gejaule bereits. Nur der Journalist Lucien Beaumont (Sylvain Dieuaide) und die spontan eingesprungene Sängerin Hazel (Frankreichs Shootingstar Christa Théret) sind neu. Trotz des unausstehlichen Gekrächzes applaudieren die Zuhörer und überschütten die Gastgeberin mit Lob – die Neuen sind verwundert. Als der Journalist Lucien am Folgetag eine begeisterte Kritik veröffentlicht, fasst Marguerite den Entschluss endlich auf einer großen Bühne in der Öffentlichkeit aufzutreten. Ihr Mann, der sich für sie schämt, versucht dies auf Teufel komm raus zu verhindern.
Der Ursprung der schiefen Töne
Die Geschichte basiert auf der reichen Erbin Florence Foster Jenkins, die in den 40er Jahren in den USA verstarb. Auf YouTube, kann man ihre unverwechselbare und wahrhaftige Interpretation der Königin der Nacht anhören. Auch sie war überzeugt von ihrer Gesangsqualität, obwohl sie keinen Ton traf. Trotzdem ist dieser Film keinesfalls eine Biografie (diese wird momentan in den USA gedreht), sondern entwickelt nach der Basis einen eigenen Handlungsstrang. Denn neben der Belustigung findet der Zuschauer einen Draht zur Innenwelt der Marguerite und begreift, dass sie eigentlich völlig einsam ist. Während den Geschäftsreisen ihres Mannes ist ihr nur die Musik geblieben und ausschließlich durch sie kann sie sich ausdrücken und etwas Aufmerksamkeit vonseiten ihres Mannes erhaschen. Denn im Grunde möchte sie nur, dass er stolz auf sie sein kann.
Die perfekte Besetzung
 Catherine Frot brilliert in ihrer Rolle als Marguerite: Sie ist überschwänglich und heiter, behält sich jedoch auch in diesen Szenen einen Kern Traurigkeit. Ihre Mimik spricht Bände, sodass sie vergleichsweise wenig sagen muss, um sich darzustellen. Ein weiterer Augenschmaus ist der exzentrische Gesangslehrer Atos Pezzini (Michel Fau), der Marguerite auf ihr großes Konzert vorbereiten soll. Er lebt für die Musik, erstarrt zur Salzsäule, als er den schaurigen Gesang der Madame zum ersten Mal hört und versucht trotz aller schlechten Omen sie bestmöglich für ihr Vorhaben zu wappnen.
Catherine Frot brilliert in ihrer Rolle als Marguerite: Sie ist überschwänglich und heiter, behält sich jedoch auch in diesen Szenen einen Kern Traurigkeit. Ihre Mimik spricht Bände, sodass sie vergleichsweise wenig sagen muss, um sich darzustellen. Ein weiterer Augenschmaus ist der exzentrische Gesangslehrer Atos Pezzini (Michel Fau), der Marguerite auf ihr großes Konzert vorbereiten soll. Er lebt für die Musik, erstarrt zur Salzsäule, als er den schaurigen Gesang der Madame zum ersten Mal hört und versucht trotz aller schlechten Omen sie bestmöglich für ihr Vorhaben zu wappnen.
Zu empfehlen
Auch wenn der Film einige Längen aufweist, ist er für jeden Musikliebhaber sehenswert. Der Facettenreichtum ist erfreulich, eine schlichte Komödie, bei der die Madame zur Witzfigur degradiert wird, wäre zu flach und bliebe unter dem möglichen Potenzial. Man lacht Tränen, hält sich die Ohren zu und leidet mit der Hauptfigur mit, die im Grunde nur um ihrer selbst willen geliebt werden möchte. Man fiebert gespannt dem großen Auftritt entgegen und hofft sie möge nun endlich die Töne treffen.
Ob Marguerite Dumonts Ehrgeiz und Wille sich am Ende gelohnt haben, könnt ihr ab dem 29. Oktober auf der Leinwand verfolgen. Von mir gibt es auf jeden Fall drei Daumen nach oben!
Fotos: © 2015 Concorde Filmverleih GmbH


 Ann-Chrisitne Strupp
Ann-Chrisitne Strupp Anne Schneider
Anne Schneider Unsplash
Unsplash Pixabay
Pixabay
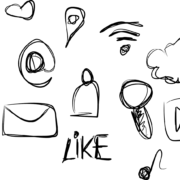 kropekk_pl auf pixabay
kropekk_pl auf pixabay


