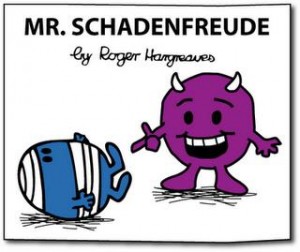Von Valerie Heck
Schlauer, aktiver, fitter – dank Technik ist das jetzt möglich. Denn immer mehr Apps und Gadgets werden entwickelt, um den Menschen in seinem Streben nach Optimierung und Perfektion zu unterstützen. Vor allen Dingen im Bereich der Gesundheit und Fitness kann der Mensch immer mehr auf die Unterstützung von Technik bauen. Aber auch die Grenzen des menschlichen Gedächtnisses können beispielsweise mit Kameras, die alle paar Sekunden ein Foto schießen, überwunden werden. Lifelogging heißt der Trend, sein Leben in all seinen Facetten aufzuzeichnen.
„Ein Stück irdische Unsterblichkeit“

Gordon Bell mit SenseCam
Was als neuster Trend des digitalen Zeitalters gilt, macht Gordon Bell schon seit Jahrzehnten. Dabei trägt der Microsoft-Ingenieur nicht nur bei jedem Schritt, den er macht, eine so genannte SenseCam um den Hals, die alle 20 Sekunden automatisch ein Bild von seiner Umgebung macht. Er speichert auch Artikel, Bücher, CDs, Briefe, Mitteilungen, Präsentationen, private Filme, besuchte Websites, tägliche Aktivitäten und sogar Transkripte von Telefongesprächen und Chats. Sein Ziel ist es, eine lückenlose Enzyklopädie seines Lebens zu erstellen. Das Ganze begann 1998 mit dem Projekt „MyLifeBits“, doch auch nach der Beendung des Projekts 2007 machte Bell mit dem Lifelogging weiter. Nach all den Jahren findet es Bell praktisch, sein digitales Gedächtnis aufrufen zu können
In seinem Buch „Your life, uploaded“ beschreibt Bell die Vorzüge des Lifeloggings: „Man gewinnt mehr Einsicht in sich selbst, die Fähigkeit, die eigene Lebensgeschichte mit proust‘scher[1] Detailtreue nachzuerleben, die Freiheit, weniger im Gedächtnis zu behalten und mehr kreativ zu denken, und sogar ein Stück irdische Unsterblichkeit, weil das Leben im Cyberspace bewahrt wird.“ (Morozov: „Smarte neue Welt“) Für Bell ist das Archivieren seiner Lebensgeschichte ein Versuch, die Grenzen des menschlichen Gedächtnisses zu überwinden.
Auch Software-Pionier Stephen Wolfram protokolliert seinen gesamten Tagesablauf und hat mittlerweile ziemlich verlässliche Daten über sein Verhalten der letzten 25 Jahre gesammelt. Seine Prämisse dabei ist allerdings: Es darf kein Aufwand dahinter stecken, die Daten zu erfassen; das Ganze muss im Hintergrund ablaufen. Technik macht dies möglich: Eine Uhr überwacht seine Herzfrequenz und seine Schritte, sein Computer macht alle 15 Sekunden einen Screenshot, seine Tastatur erfasst jeden Tastendruck, ein Mikrofon nimmt die Geräusche um ihn herum auf und eine kleine Ansteckkamera schießt alle 30 Sekunden ein Bild.
Alle Zeichen stehen auf Optimierung
Tatsächlich spielt die Technik bei dem Drang nach Optimierung eine große Rolle. Es werden Fitnessarmbänder, Smartphone Apps und immer kleinere Ansteckkameras entwickelt, damit die Menschen möglichst alle ihre Daten aufzeichnen und diese zur Optimierung der körperlichen und geistigen Leistung nutzen können.
Und die neuen Gadgets werden von den Leuten angenommen: Sie versehen ihren Körper mit Sensoren, die körperliche Parameter wie Körpertemperatur, Schritte und Herzfrequenz aufzeichnen, tragen nachts Stirnbänder zur Messung der Gehirnaktivität beim Schlaf und lassen sich von Apps vorschreiben, wie viele Kalorien sie heute noch zu sich nehmen dürfen. Kurz: Die Menschen vermessen sich selbst. Dabei ist ihr Ziel häufig die Optimierung des eigenen Lebens – man will mit Hilfe von Technik fitter, gesünder oder sogar weniger gestresst werden. Seit 2007 wird dieser Trend mit dem Begriff „Quantified-Self“ zusammengefasst. Dabei werden zwei Tendenzen der Zeit vereint: Der Wunsch nach menschlicher Perfektion und der Glaube an die Segnungen digitaler Technologie.
Die Unternehmen freuen sich…
„Alles wird verschlüsselt sein, elektronische Erinnerungen werden in Schweizer Datenbanken lagern, man wird vorsichtig und begrenzt Informationen mit anderen teilen.“ (Morozov: „Smarte neue Welt“) So spricht Gordon Bell vom Speichern der gesammelten Daten – als eine private Angelegenheit. Doch die Wirklichkeit sieht ganz anders aus: Lifelogging findet in der Öffentlichkeit statt. Damit ist nicht nur gemeint, dass Lifelogger die Fotos, die alle 20 Sekunden automatisch geschossen werden, auf verschiedenen Plattformen veröffentlichen, egal wie trivial die Situationen und unscharf die Bilder auch sind, wie diese Aufnahmen mit dem Narrativ Clip zeigen:



Sondern es ist vor allen Dingen gemeint, dass die Unternehmen durch Apps, Fitnessarmbänder und andere Anwendungen an die Daten ihrer Kunden gelangen und mit Daten lässt sich bekanntlich Geld verdienen. So gibt Travis Bogard von Jawbone, dem Hersteller von Fitnessarmbändern und –apps ganz offiziell zu, dass sein Unternehmen in Zukunft mit Daten und nicht mehr mit Hardware Geld verdienen wolle. Auch das kleine Unternehmen Exist profitiert von den Daten verschiedener Quantified-Self-Anwendungen, indem es diese nach Trends und Korrelationen durchsucht und die Ergebnisse der Analysen an die User verkauft.
Für Stefan Selke, Professor für Soziologie und gesellschaftlichen Wandel an der Hochschule Furtwangen, ist das kommerzielle Interesse an Lifelogging entscheidend für die Verbreitung des Trends und auch der Grund dafür, dass Lifelogging in Zukunft eine immer größere Rolle spielen wird. Unternehmen verdienen an den Daten und an den neuen Geschäftsideen, die sich daraus entwickeln. Denn in Zukunft sollen noch mehr Messungen als Schritt zählen und Puls kontrollieren möglich sein. Google hat bereits ein Patent für ein Armband angemeldet, das Krebszellen erkennen, zählen und am besten noch zerstören soll und wer weiß, was sonst noch in der Zukunft möglich sein wird.
Sinnloser Solutionismus?
Genau diesen kommerziellen Nutzen kritisiert der Autor des Buches „Smarte neue Welt“ Evegny Morozov: „Technologie ist ständig auf der Suche nach Problemen, die sie lösen kann, ohne dass sie einer Lösung bedürfen.“ Diese Tendenz fasst Morozov als „Solutionismus“ zusammen.
Nehmen wir das Beispiel des menschlichen Gedächtnisses, dessen natürliche Lücken für Menschen wie Gordon Bell und andere Lifelogger ein Problem darstellen, das es durch Techniken wie SenseCams, Archivierung und Lifelogging-Apps zu überwinden gilt. Sind die Lücken im Gedächtnis wirklich ein Problem oder manchmal nicht sogar nützlich, wenn man zum Beispiel ein schreckliches Ereignis aus der Vergangenheit verarbeiten möchte. Das Gedächtnis trifft eine Auswahl aus Auslöschen und Bewahren, während der Computer einfach nur speichert. Und wenn man wirklich darüber nachdenkt, braucht man auch Anwendungen wie Fitnessarmbänder oder „Schlafrhythmusüberwacher“ nicht. Doch es werden Probleme wie zu geringe Aktivität oder nicht ideale Tageseinteilung kommuniziert, die die neuste Technik überwinden kann. Und irgendwie ist es auch interessant, die Aktivität des Körpers zu überprüfen und lustig, eine unübersichtliche Menge an Fotos, die automatisch geschossen wurden, zu durchforsten und sich so an Momente zu erinnern, die man sonst wahrscheinlich vergessen hätte.
Es zeigt sich, dass durch die geschaffenen Probleme und die dadurch entwickelte Technik Trends entstehen. Daher werden auch in Zukunft „sinnlose“ Gadgets zur Optimierung des Lebens verwendet werden. Einfach, weil es sie gibt.
Literatur: Morozov, E. (2013). Smarte neue Welt: digitale Technik und die Freiheit des Menschen: Karl Blessing Verlag.
Fotos: flickr.com/N i c o l a (CC BY 2.0), flickr.com/JulianBleecker (CC BY-NC-ND 2.0), flickr.com/Roland Tanglao (CC BY 2.0), flickr.com/Roland Tanglao (CC BY 2.0), flickr.com/Roland Tanglao (CC BY 2.0)
[1] In seiner fiktiven Autobiographie „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ versucht der französische Schriftsteller Marcel Proust vergeblich, sich an seine Kindheit und Jugend zu erinnern. Es helfen ihm schließlich eine Reihe von „unwillkürlichen Erinnerungen“ oder Sinnesassoziationen, die Erlebnisse der Vergangenheit auf intensive Weise vergegenwärtigen und damit erinnerbar machen.



 Media Bubble
Media Bubble