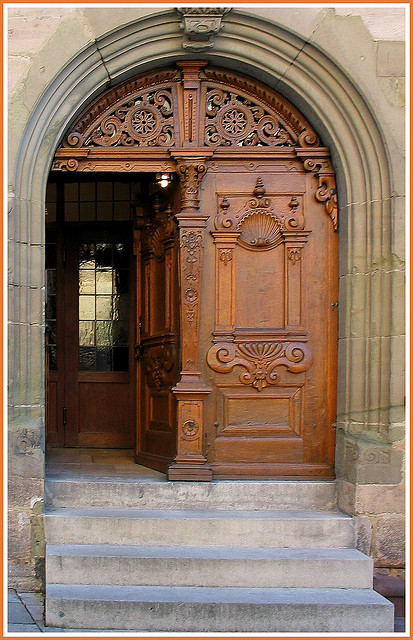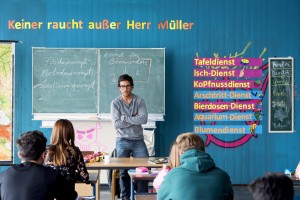Das Transmediale Phänomen The Walking Dead
Von Philipp Mang
Lange Zeit fristeten Comics in unserer Gesellschaft ein Nischendasein. Sie wurden belächelt, geächtet und sogar auf Scheiterhaufen verbrannt. Heute begeistern so genannte graphic novels die Massen. Das liegt vor allem daran, dass Hollywood die Stoffe immer häufiger für die große Leinwand adaptiert – mit riesigem Erfolg: So basieren drei der zehn erfolgreichsten Filme aller Zeiten laut Box-Office Ranking auf einer Bildergeschichte (u.a. Marvel’s The Avengers und Iron Man 3). Interessanterweise lassen sich ein Großteil dieser Werke dabei dem Superhelden-Genre zuordnen. Doch nicht nur Comic-Filme brechen derzeit alle Rekorde. Auch bei amerikanischen Fernsehsendern erfreuen sich die zumeist kosmischen Geschichten immer größerer Beliebtheit. Allein in den letzten Jahren sind hier mit Arrow, Gotham, Supergirl und The Flash eine Flut von Serien-Adaptionen entstanden.
Warum Comics Hollywood erobern …
 Wer diese Entwicklung nun allein auf die mangelnde Kreativität der Drehbuchautoren in Hollywood zurückführt, der irrt. Tatsächlich lässt sich die Anziehungskraft von Comics auf Film- und Serienmacher vor allem durch die enorme Visualität des Mediums erklären. Bei Comicadaptionen kann beispielsweise auf die Entwicklung so genannter Storyboards verzichtet werden. Hierbei handelt es sich um meist skizzenhafte Darstellungen des Drehbuchs. Diese sollen Produzenten bereits früh eine genaue Vorstellung von der Umsetzung der Geschichte vermitteln. Ein weiterer Grund für die Popularität von Comicadaptionen liegt in der sowohl seriellen als auch episodischen Erzählweise der Vorlagen. Darüber hinaus können die Bildergeschichten oft auf eine bereits etablierte Zuschauerschaft zurückgreifen – angesichts zahlreicher loyaler Fans scheinen hohe Zuschauerzahlen so nur noch reine Formsache zu sein.
Wer diese Entwicklung nun allein auf die mangelnde Kreativität der Drehbuchautoren in Hollywood zurückführt, der irrt. Tatsächlich lässt sich die Anziehungskraft von Comics auf Film- und Serienmacher vor allem durch die enorme Visualität des Mediums erklären. Bei Comicadaptionen kann beispielsweise auf die Entwicklung so genannter Storyboards verzichtet werden. Hierbei handelt es sich um meist skizzenhafte Darstellungen des Drehbuchs. Diese sollen Produzenten bereits früh eine genaue Vorstellung von der Umsetzung der Geschichte vermitteln. Ein weiterer Grund für die Popularität von Comicadaptionen liegt in der sowohl seriellen als auch episodischen Erzählweise der Vorlagen. Darüber hinaus können die Bildergeschichten oft auf eine bereits etablierte Zuschauerschaft zurückgreifen – angesichts zahlreicher loyaler Fans scheinen hohe Zuschauerzahlen so nur noch reine Formsache zu sein.
Zombies brechen Rekorde
Die dystopische Horror-Serie The Walking Dead ist ebenfalls ein Produkt dieses neuen Hollywood-Trends. Auch sie basiert auf einem Comic (von Robert Kirkman) und bricht seit ihrer Erstausstrahlung im Jahr 2010 auf dem Sender AMC regelmäßig Quotenrekorde. Mit über 15 Millionen Zuschauern gehört sie zu den erfolgreichsten Serien in der Geschichte des amerikanischen Kabelfernsehens. Seit Staffel 2 wird die Sendung deshalb zusätzlich von einer einstündigen Talkshow (The Talking Dead) begleitet. Cast, Crew und Fans lassen hierin noch einmal die zentralen Ereignisse der vergangenen Folge Revue passieren. Mittlerweile haben selbst Kritiker Gefallen an den lebenden Toten gefunden – so wurde die Serie unlängst mit dem wohl bedeutendsten Fernsehpreis der Welt ausgezeichnet: dem Emmy. Und auch an den Universitäten des Landes setzt man sich immer häufiger wissenschaftlich mit dem popkulturellen Phänomen auseinander.
Ein multimediales Franchise
Amerika ist jedoch nicht das einzige Land, in dem der Hype um The Walking Dead keine Grenzen kennt. Längst hat sich die Serie zu einem internationalen Medienereignis entwickelt, das über verschiedenste Kanäle auf der ganzen Welt erzählt wird. So sind aus dem Comic nicht nur eine Fernsehsendung, sondern auch zahlreiche Webserien, Computerspiele und Apps hervorgegangen. Im Mittelpunkt des Franchise steht dabei der Polizeibeamte Rick Grimes, der nach einer gefährlichen Schussverletzung ins Koma fällt. Als er wieder zu sich kommt, findet sich der Sheriff in einer alptraumhaften postapokalyptischen Welt wieder, in der Tote durch ein Virus wieder auferstehen und die Lebenden attackieren. Gemeinsam mit anderen Überlebenden macht sich Rick auf die Suche nach seiner Familie und kämpft fortan täglich um sein Überleben – ein Plot der beim Publikum Anklang findet, denn mittlerweile zählt die internationale Facebookseite der Serie mehr als 32 Millionen Fans.
Faszination TWD – ein Ausblick
Wie ist diese einzigartige Erfolgsgeschichte aber zu erklären, wo doch der Serienmarkt von Comicadaptionen in den letzten Jahren zunehmend überschwemmt wird? Wodurch hebt sich The Walking Dead von anderen Genre-Vertretern ab? Oder anders ausgedrückt: Was fasziniert die Menschen auf dem ganzen Globus so stark an diesem Franchise? Die folgende Artikelreihe unternimmt den Versuch genau diese Fragen zu beantworten. Hierfür werden mit den titelgebenden „Walkern“ und dem postapokalyptischen Setting zunächst zwei zentrale Gründe für die generelle Faszination des Publikums beleuchtet. In einem nächsten Schritt soll es dann um spezielle Gestaltungsmerkmale der TV-Serie gehen, die sich entscheidend auf das Rezeptionserlebnis auswirken können. So zeichnet sich die Sendung beispielsweise nicht nur durch eine explizite Darstellung von Gewalt, sondern auch durch die Verhandlung moralischer Dilemmata aus. Charakteristisch ist außerdem, dass die Geschichte über unterschiedliche mediale Plattformen erzählt wird. Abschließend sollen deshalb zwei unbekanntere Dimensionen des Franchise näher vorgestellt werden: die Computerspiele und Webserien. Ein Streifzug durch die transmediale Welt von The Walking Dead beginnt …
Fotos: Flickr.com/Heather Paul (CC BY-ND 2.0); Flickr.com/Dave (CC BY-ND 2.0)