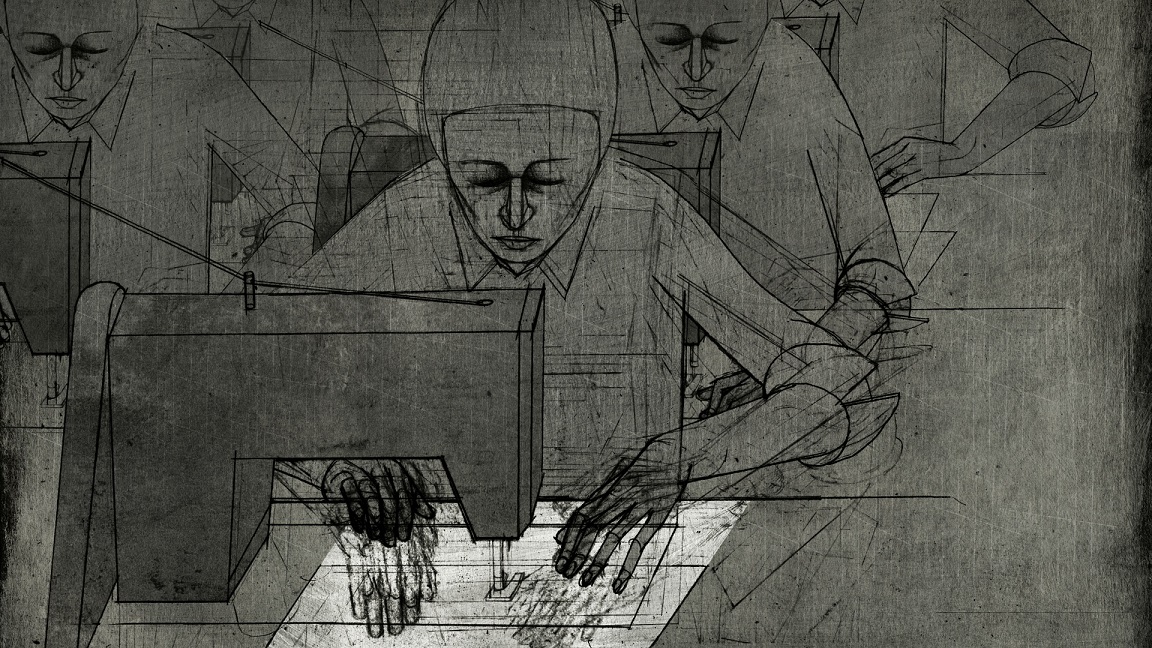Wenn Leid zu Glück wird – Der Eurovision Song Contest 2016
von Sonja Sartor
Die Halle liegt im Dunkeln. Allein die weißen Lichtpunkte im Publikum lassen einen erahnen, wie viele Menschen sich hier tummeln. Dann erklingt der erste Takt und das Scheinwerferlicht wird auf den Künstler geworfen. Die Menge tobt. Die Flaggen werden wieder freudig geschwenkt.
Am 14. Mai war es wieder soweit: Der Vorjahresgewinner Schweden lud Europa zum 61. Eurovision Song Contest nach Stockholm ein. Aber dieses Jahr war der Wettbewerb noch ein Stück gigantischer, denn zum ersten Mal wurde die Show nach China und in die USA übertragen. So ging ein bunter, friedlicher und mitreißender Song Contest über die Bühne, der für manche Überraschung sorgte. Zusammenfassungen des ESC findet man online zuhauf; media-bubble konzentriert sich gemäß der Reihe „Medienperspektiven à la française“ auf den Auftritt des französischen Kandidaten.
Ein Hoffnungsschimmer für Frankreich
Mit dem ersten Ton scheint der junge Mann in seinem schwarzen Anzug und den weißen Sneakers die Herzen der Zuschauer für sich gewonnen zu haben. Vor 16.000 Zuschauern in der Halle und geschätzten 100 Millionen Zuschauern vor den Fernsehbildschirmen singt er sein Lied, als hätte er nie etwas anderes gemacht. „J’ai cherché“ (dt. Ich habe gesucht) ist ein eingängiger und gute Laune verbreitender Popsong, der perfekt zu seinem Interpreten passt.
Das Lied handelt davon, auf der Suche nach dem richtigen Weg zu sein. Amir, der israelisch-französische Sänger mit dem ansteckenden Dauerlächeln, kennt dieses Gefühl nur zu gut. Dem gelernten Zahnarzt fehlte etwas in seinem Leben. Er wollte morgens mit dem Gedanken aufwachen, dass er in seinem Beruf glücklich ist. Schließlich fand er das, was ihm fehlte und machte die Musik zu seinem Beruf. Dann wurde er 2014 im französischen Format von The Voice bekannt und belegte den dritten Platz.
Seinen musikalischen Höhepunkt hat Amir wohl dieses Jahr mit der Teilnahme am Eurovision Song Contest erreicht. Besonders an „J’ai cherché“ ist, dass es in französischer wie auch englischer Sprache gesungen wird. Bekanntlich ist das französische Volk sehr stolz ist auf die eigene Sprache. Es wundert also nicht, dass sich ein französischer Staatssekretär, zu dessen Aufgabenbereich die Frankophonie zählt, im Vorfeld des Wettbewerbs seiner Empörung über das Lied bei Twitter Luft machte. Es sei „bestürzend und inakzeptabel“, dass ein Lied mit englischem Refrain Frankreich repräsentieren würde, so André Vallini.
Amir, der selbst aus einer multikulturellen Familie stammt, wollte mit der Zweisprachigkeit ein Zeichen setzen: „Die englischen Sätze dienen eigentlich nur dazu, dass die Zuschauer verstehen, was ich singe. Sie ermöglichen, dass wir die Menschen von unserer Botschaft und von unserem Lied überzeugen können.“ Immerhin seien 80 Prozent des Textes französisch. Frankreich möchte ein positives Bild der Grande Nation vermitteln. Es soll zeigen, dass sich das Land trotz all der schrecklichen Ereignisse der letzten Monate nicht unterkriegen lässt und optimistisch in die Zukunft blickt.
Ein schwedischer Milchbubi, eine Australierin auf einer Glitzerkiste und ein emotionales Klagelied
Belgien durfte mit Laura Tesoro, einer jungen Frau mit wildem Lockenkopf und Paillettenkostüm, den Wettbewerb eröffnen. Sie legte mit ihrem Popsong einen gelungenen und energievollen Auftritt hin. Kraftvoll ging es dann auch weiter mit typischen ESC-Momenten: halbnackte Trommler, Sängerinnen in hautengen, funkelnden Abendroben, kuriose Frisuren und verblüffende Lichteffekte. Manche Auftritte wie die des schwedischen Frans, dem lieben Jungen von Nebenan, beeindruckten durch ihre Schlichtheit und Unaufgeregtheit. Australien, zum zweiten Mal vertreten unter den Kandidaten, hatte eine zierliche Frau ins Rennen geschickt. Auf einem glitzernden Kubus performte Dami Im das Lied „Sound of Silence“ und nahm mit ihrer erstaunlich kraftvollen und klaren Stimme die gesamte Halle ein.
 Jamala aus der Ukraine fiel mit ihrem Song „1944“ komplett aus der Reihe. Dramatisch und nahezu jammernd inszenierte sie in diesem traurig-schönen Klagelied die Geschichte von der Vertreibung der Krimtataren. Russland hält das Lied für politisch motiviert und sieht es als Provokation angesichts der Krim-Annexion von 2014. Ob Politikum oder nicht, Jamala schaffte es, die Zuschauer in ihren Bann zu ziehen.
Jamala aus der Ukraine fiel mit ihrem Song „1944“ komplett aus der Reihe. Dramatisch und nahezu jammernd inszenierte sie in diesem traurig-schönen Klagelied die Geschichte von der Vertreibung der Krimtataren. Russland hält das Lied für politisch motiviert und sieht es als Provokation angesichts der Krim-Annexion von 2014. Ob Politikum oder nicht, Jamala schaffte es, die Zuschauer in ihren Bann zu ziehen.
Der deutsche Song schien dagegen mit der Konkurrenz nicht mithalten zu können. Solide und sympathisch, aber mehr leider nicht. Er war eben anders als „Ein bisschen Frieden“, mit dem Nicole 1982 die ESC-Trophäe nach Deutschland geholt hatte. Damals hatte die erst 17-Jährige ihr Lied in sieben Sprachen vorgetragen.
Verstanden zu werden war den meisten Künstlern sichtbar wichtig. Wenige Songs griffen die eigene Landessprache auf, Österreich hatte sich sogar für einen vollständig französischen Song entschieden. Englisch war die Sprache des Abends.
Durch das neue Abstimmungsverfahren, bei dem zuerst die Punkte der Länderjurys und dann der Zuschauer zusammengetragen werden, wurde bewusst Spannung bis zur letzten Minute erzeugt. Australien und die Ukraine lieferten sich ein Kopf-an-Kopfrennen, bis mit der letzten Punktevergabe feststand, dass der Sieg an die Ukraine geht.
Stolzes Frankreich
Auch Amir aus Frankreich hat Grund zu feiern. Er landete mit 257 Punkten auf dem sechsten Platz, was Frankreichs beste Platzierung seit 2002 darstellt. Zwar wartet sein Heimatland seit 1977 auf einen erneuten Sieg, aber der Sänger ist sich nach der Show sicher, dass er mit seinem Auftritt Frankreich ein Stück seines Stolzes zurückgegeben hat.
Fotos: wikimedia.org/Albin Olsson (CC BY-SA 4.0), wikimedia.com/Albin Olson (CC BY-SA 4.0)