Resilienz in der Klimakrise
Warum innere Stärke äußeren Wandel beeinflussen kann
Von Ann-Katrin Bergob
Besonders junge Menschen werden angesichts der Klimakrise zunehmend von Gefühlen der Überforderung, der Ohnmacht und der Zukunftsangst geplagt. Denn die Klimakrise spielt sich nicht nur vor unserer Haustür ab, sondern längst auch in unserem Inneren. Wer hat sich nicht schon einmal nach der eigenen Rolle im Klimawandel gefragt und dann vor lauter Überforderung und Hilflosigkeit die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen? Neben der ökologischen gibt es auch die psychologische Dimension, die oft vergessen wird.
Welche psychologischen Faktoren und Auswirkungen hat die Klimakrise? Wie können wir mit diesem Wissen innere Stärke entwickeln?
„Was, wenn es schon zu spät ist?“ – „Wie soll ich erst meine Zukunft planen, wenn ich mir schon jetzt bei jedem Wocheneinkauf den CO2-Abdruck meiner Entscheidungen durchrechne?“ – „Ich habe das Gefühl, alles tun zu müssen, obwohl gleichzeitig nichts reicht.“ – „Ich schwanke ständig zwischen Konsumwerbung und Klimakatastrophe.“
Solche Gedanken begleiten heute viele Menschen, insbesondere die jüngere Generation. Die Klimakrise ist für sie nicht nur eine Umweltfrage, sondern eine große, persönliche Herausforderung. Sie sorgt für Angst vor einer ungewissen Zukunft, Wut auf die Verantwortlichen und Resignation anhand der überfordernden Klimalage. Außerdem verstärkt sie das lähmende Gefühl, dieser umfassenden klimatischen Bedrohung einschließlich aller psychologischen Nebenfaktoren schutzlos ausgeliefert zu sein.
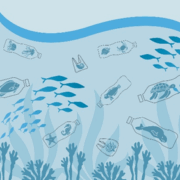
Dabei sollte es nicht darum gehen, diese Gefühle zu ertragen oder wegzuschieben. Vielmehr stellt sich die Frage: Wie können wir mit ihnen leben, ohne daran zu zerbrechen und ohne innerlich aufzugeben? Eine hilfreiche Perspektive bietet das psychologische Konzept der Resilienz.
Was bedeutet Resilienz? – Eine Begriffsklärung
Resilienz beschreibt nicht die Abwesenheit oder das Wegschieben von negativen Gefühlen wie Schmerz oder Angst, sondern die Fähigkeit, schwierige Erfahrungen so zu verarbeiten, dass neue Perspektiven entstehen. Es geht in einem ersten Schritt um die Bewältigung von Krisen, also um die Thematisierung und Reflexion von den damit einhergehenden Konsequenzen. Resilienz bedeutet jedoch auch, noch einen Schritt weiterzugehen und Krisen nicht nur zu verarbeiten, sondern sich an sie anzupassen. Es geht darum, langfristig eine konstante Selbstreflexion, Kohärenz und Ausdauer aufzubauen. Kurz gesagt: eine unerschütterliche innere Stärke, auf die in schwierigen Krisenzeiten Verlass ist.
In Zeiten der Klimakrise wird diese emotionale Widerstandsfähigkeit für viele Menschen zu einer wichtigen Unterstützung – nicht als einfache Lösung, sondern als Ressource im Umgang mit einer Krise, die oft überfordert. Daher stellt sich zum einen die Frage, welche psychischen Folgen die Klimakrise hervorruft und zum anderen, wie Resilienz angesichts dieser Herausforderungen erlangt werden kann.
Wie beeinflusst die Klimakrise die mentale Gesundheit der Menschen?
Magdalena Gawrych, die Psychologie an der Maria Grzegorzewska Universität in Warschau lehrt, unterscheidet zwischen Einwirkungen auf die Psyche der Menschen durch direkte, indirekte und ferne Katastrophen, die durch den Klimawandel verursacht werden. Flutkatastrophen oder Waldbrände können beispielsweise zu Entwurzelung, Trauma und Trauer führen. Indirekte und ferne Katastrophen hingegen werden nicht miterlebt, aber können dennoch Auswirkungen auf die Psyche in Form von Scham und Schuldgefühlen haben. Auch Wut, Angst oder die Suche nach Verantwortlichen sind mögliche Konsequenzen, ebenso wie Verzweiflung, Zwiespalt und Resignation. Gerade soziale Medien verstärken diese Gefühle oftmals, da sie die Katastrophen indirekt erlebbar, nachvollziehbar und nahbar machen.

Wie können Resilienz und Klimakrise so verbunden werden, dass ein individueller und gesellschaftlicher Nutzen entsteht?
Diese Vorschläge können bei der Bewältigung von Überforderung, Hilflosigkeit und Resignation helfen und die Resilienz im Angesicht der Klimakrise stärken:
- Akzeptanz anstelle von Verdrängung.
Nicht vor dem Problem weglaufen, sondern sich aktiv damit auseinandersetzen. Es ist zentral, die Klimakrise als real zu akzeptieren, um darauf aufbauend konstruktiv handeln zu können. Akzeptanz steht in diesem Zusammenhang nicht für Passivität, sondern für eine Notwendigkeit, ohne die es keinen Handlungsbedarf gibt. - Gefühle zulassen und nicht nur die negative Seite betrachten.
Laut Dr. Lauren Chiu, einer Psychologin am Royal Melbourne Hospital, können negative Gefühle häufig die stärksten Motivatoren sein. Wenn wir beginnen, unsere negativen Gefühle ernst zu nehmen, zu verstehen und mit ihnen umzugehen, dann gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung resilientem Umgang mit der Klimakrise. Aus Resignation und Zorn könne beispielsweise der starke Antrieb resultieren, etwas zu verändern. Schuld und Scham hingegen können zu einem stärkeren gesellschaftlichen und umweltbewussten Handeln führen. Wie Chiu betont, seien durch die Klimabedrohung ausgelöste, negative Gefühle somit nicht nur eine Konsequenz dieser Krise, sondern stellen im Umkehrschluss eine notwendige Voraussetzung für Handlungsmotivationen dar. - Passivität in Aktivität umwandeln.
Chiu drückt aus, dass sowohl gemeinschaftliches als auch individuelles Handeln für das Klima einen schützenden Effekt auf die Psyche hat. Sei es also mit einem eigenen Blog, in einer Hochschulgruppe oder mit Freunden: Wandle Passivität in Aktivität um. Dies funktioniert auf viele Arten – ob durch Aktivismus, Bildungsarbeit oder Klimagespräche. Wie Clayton und Parnes zeigen, kann Aktivismus positive Auswirkungen besonders auf Gefühle wie Scham, Schuld, Antriebslosigkeit und Resignation haben.
- Ein Bewusstsein für die eigene Verantwortung entwickeln. Es ist wichtig ein Gefühl dafür zu entwickeln, was in der eigenen Verantwortung liegt und somit geändert werden kann und was sich der individuellen Einwirkung entzieht. Darüber hinaus ist es wichtig, sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren. Pausen sind in Ordnung, genauso wie Grenzen zu setzen und sich mal einen Tag nicht mit dem Klimawandel zu beschäftigen. Psychische Ressourcen können nur aufrechterhalten und geschützt werden, wenn ihnen Zeit für Regeneration gegeben wird.
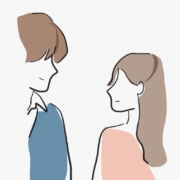
- Du bist nicht allein. Auch wenn es sich hin und wieder so anfühlen mag: Niemand von uns ist allein in dieser Krise. Sozialer Austausch und die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten kann Räume und Dimensionen öffnen. Gegen Isolation, jedoch für Austausch, Miteinander und Hoffnung.
Bei all diesen Punkten gilt es außerdem zu beachten: Es sollte nicht nur die mentale Gesundheit im Fokus stehen, sondern ebenso die Ermöglichung eines nachhaltigen Engagements. Dieses kann getragen werden durch:
- Zivilgesellschaftliche Organisationen, die Gemeinschaft und Verbundenheit ermöglichen.
- Angemessene Klimakommunikation: Nicht nur über die Krise(n) zu reden, sondern nach Lösungen zu suchen und diese umzusetzen.
- Die Veränderung kultureller Narrative: Von Schuld hin zu Mut, von Verzicht hin zu Fürsorge und Gerechtigkeit. Wie wir über die Klimakrise reden, prägt unser Mindset und hat somit Einfluss auf unsere Resilienz.
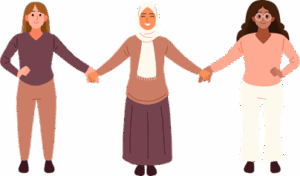
Fazit
Überforderung, Resignation oder ein mentaler Zusammenbruch: Die Klimathematik erhöht den Druck auf jede/n Einzelne/n. Resilienz bietet jedoch eine Möglichkeit, mit diesen psychologischen Begleiterscheinungen der Klimakrise umzugehen und sie möglicherweise sogar in etwas Gutes zu verwandeln. Anhand der vorgestellten Möglichkeiten eines Umgangs mit der Krise sowie zum Aufbau einer Klima-Resilienz lässt sich zeigen: Die psychologischen Auswirkungen des Klimawandels sind nicht das Ende, sondern eröffnen neue Handlungsmöglichkeiten.

Quellenverzeichnis und weiterführende Links:
- Anna Seth, Janie Maxwell, Cybele Dey, Charles Le Feuvre, Rebecca Patrick: Understanding and managing psychological distress due to climate change. Online einsehbar unter: https://www1.racgp.org.au/ajgp/2023/may/understanding-and-managing-psychological-distress [zuletzt abgerufen am 04.08.2025].
- Esther Carmen et.al.: Building community resilience in a context of climate change: The role of social capital. Online einsehbar unter: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35015248/ [zuletzt abgerufen am 13.07.2025].
- Lauren Chiu: Climate change and mental health: Global challenges for psychosocial resilience and recovery. Online einsehbar unter: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37906158/ [zuletzt abgerufen am 13.07.2025].
- Magdalena Gawrych: Climate change and mental health: a review of current literature. Online einsehbar unter: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37074836/ [zuletzt abgerufen am 13.07.2025].
- Marc O. Williams and Victoria M. Samuel: Acceptance and commitment therapy as an approach for working with climate distress. Online einsehbar unter: https://www.cambridge.org/core/journals/the-cognitive-behaviour-therapist/article/acceptance-and-commitment-therapy-as-an-approach-for-working-with-climate-distress/FBA5224AB25B44F9F02F2BB143C55628 [zuletzt abgerufen am 04.08.2025].
- Matthew Ballew, Teresa Myers, Sri Saahitya Uppalapati, Seth Rosenthal, John Kotcher, Eryn Campbell, Emily Goddard, Edward Maibach und Anthony Leiserowitz: Is distress about climate change associated with climate action? Online einsehbar unter: https://climatecommunication.yale.edu/publications/distress-about-climate-change-and-climate-action/ [zuletzt abgerufen am 04.08.2025].
- Matthew Gieve, David Drabble, Rhiannon Copeland, Francis Clay und Giorgia Iacopini: Climate change, mental health and wellbeing – a review of emerging evidence. Online einsehbar unter: https://era.ed.ac.uk/bitstream/handle/1842/43469/CXC-Climate-change-mental-health-and-wellbeing-%e2%80%93-a-review-of-emerging-evidence-Sept-2024.pdf?sequence=3&isAllowed=y [zuletzt abgerufen am 04.08.2025].
- Shona C. Easton-Gomez, Mike Mouritz und Jessica K. Breadsell: Enhancing Emotional Resilience in the Face of Climate Change Adversity: A Systematic Literature Review. Online einsehbar unter: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/21/13966 [zuletzt abgerufen am 04.08.2025].
- Susan Clayton und McKenna F. Parnes: Anxiety and activism in response to climate change. Online einsehbar unter: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X25000090?via%3Dihub [zuletzt abgerufen am 13.07.2025].



