Female Rage in Film und Serie
Zwischen Empowerment und Ästhetisierung
Von Chiara-Marie Usai
Wütend, laut, kontrolliert, blutig – weibliche Wut ist heute in Film und Serie präsenter denn je. Doch was verrät diese neue Sichtbarkeit über unsere Gesellschaft – und über das Bild der Frau, das medial konstruiert wird?
Wütende Frauen galten im Film lange als unsympathisch, hysterisch oder gefährlich – oder kamen gar nicht erst vor. Statt offener, realitätsgetreuer Wut dominierte die Darstellung stiller Trauer, romantisierten Leids oder emotionaler Zurückhaltung. Heute jedoch scheint „female rage“ auf unseren Bildschirmen allgegenwärtig zu sein: mal als radikaler Akt feministischen Empowerments, mal als stilisiertes Spektakel.
Der folgende Artikel analysiert, wie sich dieser Wandel in filmischen Darstellungen vollzieht – und was er über gesellschaftliche Machtverhältnisse, Rollenerwartungen und das Bild von Weiblichkeit offenbart.
Amy Dunne (Gone Girl, 2014) sitzt im Auto und schnippt einen Stift nach dem anderen aus dem Fenster – jeder ein leiser Abschied von der Frau, die sie so lange gespielt hat. Neben ihr liegt ihre seitenlange To-Do-Liste: ein minutiöser Bauplan für ihre selbstinszenierte Entführung (01:06:14) – nicht aus Angst, sondern aus Kalkül. Ihre Wut ist strategisch, kontrolliert, verborgen unter der Rolle der perfekten Ehefrau, von der sie sich nun abwendet. In Killing Eve (ab 2018) dagegen bewegt sich Villanelle mit blutiger Konsequenz durch Europa – nicht als Opfer, sondern als Täterin. Ihre Wut ist extravagant, offen und selbstbewusst: keine stille Rebellion, sondern ein Spektakel. Beide Charaktere tragen ihre Wut mit Stolz – die eine kalkuliert und verborgen, die andere exzessiv und offen. Was früher eine Randnotiz war, steht nun im Zentrum: weibliche Wut, die nicht bittet, sondern handelt.
Ganz anders sah das ein paar Jahrzehnte zuvor aus. In Breakfast at Tiffany’s (1961) trägt Holly Golightly keine Wut, sondern eine wohl platzierte Traurigkeit – etwas, das sie bewusst zeigt, weil es erlaubt ist. Auch in Pretty Woman (1990) bleibt der Schmerz der Hauptfigur charmant verpackt und am Ende erlöst durch romantische Zuwendung. Aber Wut? Fehlanzeige. Stattdessen dominierte ein weibliches Gefühlsrepertoire aus Zurückhaltung, Sehnsucht und Schweigen.
Unsichtbare Wut – wie Filme jahrzehntelang von schweigenden Frauen erzählten

Weibliche Charaktere zeigten oft nur Traurigkeit, während Wut unsichtbar bleibt oder verschwiegen wird. Bild: unplash.
Die Gefühlspalette weiblicher Figuren blieb lange Zeit limitiert: Zorn war tabu, erlaubt waren allenfalls weichgezeichnete Emotionen – Schmerz statt Wut, Melancholie statt Auflehnung. In klassischen Hollywoodfilmen durften Frauen traurig, verunsichert oder liebesbedürftig sein, aber niemals laut oder wütend. Das Bild der Frau war fest verankert im Ideal der Sanftheit und Passivität.
Ein Beispiel für diese Haltung liefert Breakfast at Tiffany’s (1961). Holly Golightly reagiert nicht mit Wut, sondern mit kontrollierter Traurigkeit – selbst als sie mit Drohungen und Erpressungen konfrontiert wird, bleibt sie charmant und verständnisvoll. Auch in der letzten Szene wird das Ergebnis gesellschaftlicher Erwartungen deutlich, indem sich Holly, weinend dazu zwingt, den Ring anzunehmen (01:50:10) – ein Charakter, der durch einen Freiheitsgeist definiert wird, zwingt sich in eine weitere Rolle in der Hoffnung, von Schmerzen und innerer Orientierungslosigkeit „erlöst“ zu werden.
Auch Pretty Woman (1990) zeigt, wie das Ausbleiben weiblicher Wut zur normativen Präsentation in Medien wurde. Vivian, ein zu Beginn sehr selbstbestimmter Charakter, wird schon innerhalb kürzester Zeit in eine neue, passende Rolle gedrängt. Ihre Eigenständigkeit wird durch äußere Anpassung ersetzt. Doch Vivians Unbehagen kann am ständigen „fidgeting“ erkannt werden als Edward, der wohlhabende Geschäftsmann und männliche Hauptcharakter, beginnt ihr Aussehen und ihre Kleidung zu kontrollieren (00:16:48). Dabei folgt der Film einem vertrauten, veralteten Skript: Männer, die formen und Frauen, die gehorchen – und dabei steht’s freundlich bleiben. Wut? Unerwünscht. Weibliche Figuren mussten dem Prinzip „be a good girl and shut up“ folgen. Diese historische Unsichtbarkeit weiblicher Wut hat Konsequenzen: Frauen werden entweder romantisiert, stigmatisiert – oder ganz ausgeblendet. Die Zuschreibung „hysterisch“ wurde zum disziplinierenden Etikett.
Rage as Power: wenn Wut zur feministischen Waffe wird
Bereits in den 1970er-Jahren begann sich die Darstellung von Frauenfiguren im Film zu wandeln. Doch markante Charaktere, die weibliche Wut offen verkörpern, fanden erst später ihren Weg auf die Leinwand.
Figuren wie Amy Dunne in Gone Girl oder Villanelle in Killing Eve sind nicht länger angepasst oder leise – sie agieren. Ihre Wut wird zur Waffe, manchmal buchstäblich. In einer Kultur, in der Gewalt lange männlich konnotiert war, ist ihre Aneignung durch Frauen ein Tabubruch – und ein notwendiger Schritt zur Emanzipation.
Amy Dunne nutzt das Ideal der „Amazing Amy“, ein Buchcharakter, den ihre Mutter schaffte, als Fassade – eine Rolle, die sie gezielt spielt, um Erwartungen zu erfüllen. Sie stellt den Mythos des „Cool Girl“ bloß – jener Frau, die alles tut, um zu gefallen und niemals wütend auf ihren Mann wird. Ihre Rebellion gegen dieses geschaffene Idealbild einer Frau ist kein emotionaler Ausbruch, sondern eine bewusste Entscheidung, ihre Wut offenzulegen – „I’m not sad. I’m angry!“ (01:34:10).
Auch Villanelle in Killing Eve tötet nicht nur, sie inszeniert sich. Ihre Kleidung, ihre Sprache, ihr gesamtes Auftreten sind nicht bloß eine Verkleidung, sondern auch eine ironische Parodie auf gesellschaftlich etablierte Weiblichkeitsklischees. Ihre Gewalt hingegen ist exzessiv und performativ. Sie bricht damit das Bild der sanften Frau – und zeigt, wie sich Macht durch Inszenierung aneignen lässt.
In Barbie (2023) wird die weibliche Wut weniger blutig, aber nicht weniger eindringlich. Gloria spricht im zentralen Monolog über den ständigen Druck, als Frau „nicht zu viel und nicht zu wenig“ zu sein (01:10:49) – eine Aussage, mit der sich viele Zuschauerinnen identifizieren konnten. Im Kontrast zur stilisierten Wut der anderen Figuren ist Glorias Rede radikal, weil sie ehrlich ist – und damit umso bedeutsamer.
Wut, die gut aussieht: Feminismus zum Streamen?
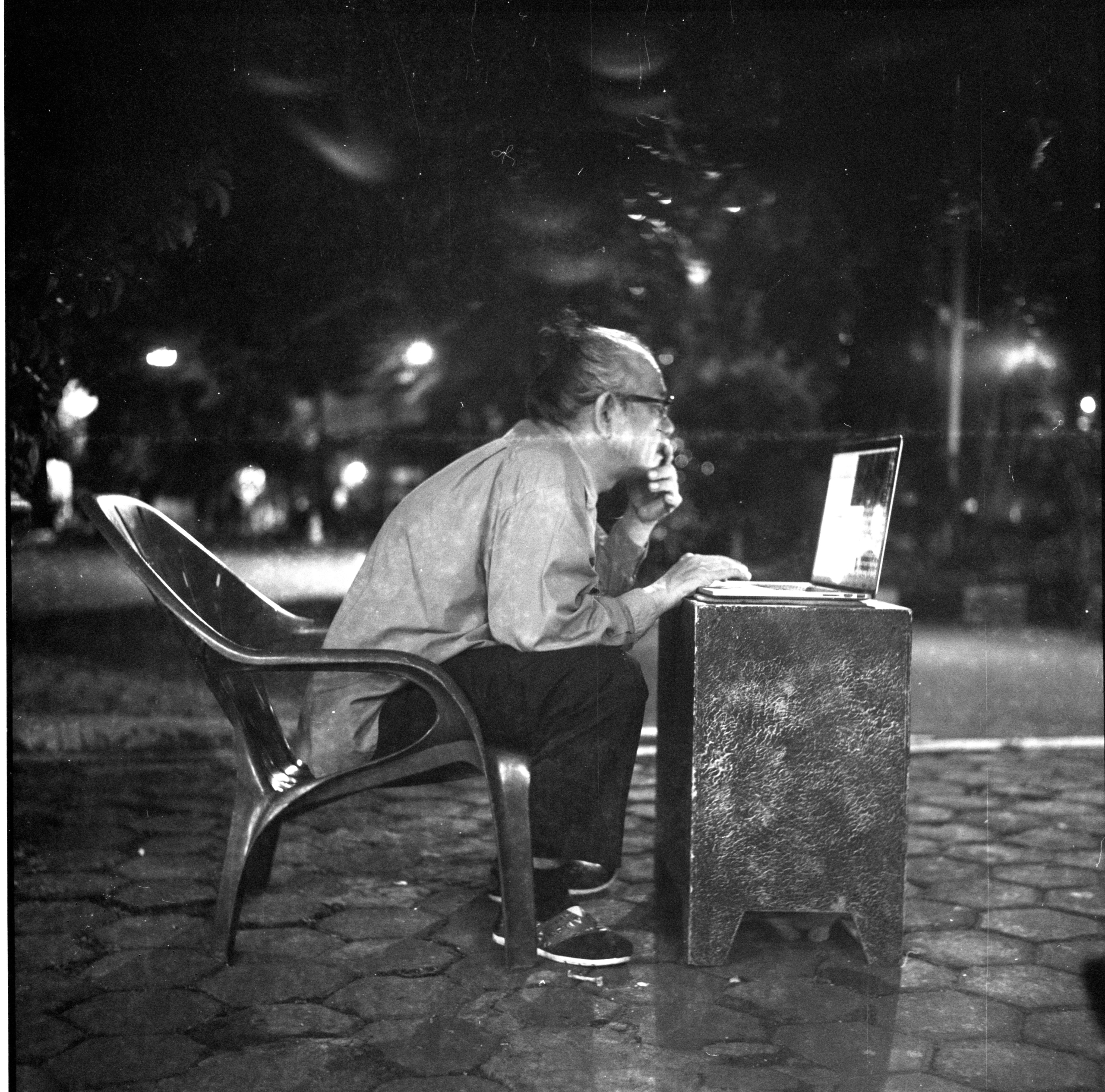
Die Darstellung weiblicher Wut wird durch die Medien zu einem ästhetisierten Spektakel. Bild: unplash.
Doch die Inszenierung weiblicher Wut bleibt ambivalent. Wenn Amy blutverschmiert nach dem Mord in Desis Luxuyhaus posiert (02:06:35), wenn Villanelle in Designer-Outfits mordet oder Barbie im perfekten Make-Up weint (01:02:10) – dann wird Wut ästhetisch aufgeladen, in Szene gesetzt, statt hinterfragt. Sie wird konsumierbar gemacht – als Style-Element, nicht als politischer Ausdruck.
Pretty Woman zeigte bereits, wie sich „abweichende“ Weiblichkeit durch Kleidung, Make-Up und Verhalten normieren lässt. Vivian wird äußerlich angepasst, um in eine patriarchale Welt zu passen – ihre eigene Identität bleibt dabei unsicher. Es ist eine Inszenierung von Geschlecht als gesellschaftlich akzeptierte Rolle.
Auch Barbie entscheidet sich, Mensch zu werden – und damit gegen die perfekte hyperfeminine Inszenierung, die ihr lange zugeschrieben wurde (01:37:38). Ihre Wandlung ist ein bewusster Ausstieg aus der Rolle der stereotypischen Idealfrau. Auch die Szene, in der alle Kens gleichzeitig Gitarre spielen (01:23:47), entlarvt die Absurdität dieser geschlechterbasierten Aufführungen.
Zwischen Tabubruch und Trendprodukt
Was als Befreiung beginnt, droht zum neuen Standard zu werden. Die Industrie hat entdeckt, dass Wut sich gut vermarkten lässt – solange sie ästhetisch inszeniert wird. Feminismus zum Streamen, der konsumierbar ist, aber seiner politischen Schärfe beraubt wird.
Das Problem: Die Repräsentation zeigt nicht nur die Realität, sie formt diese auch. Der Cool-Girl-Monolog, der Gloria-Monolog – sie wirken, weil sie ehrlich sind. Mit nur wenigen Filmen und Serien bleiben sie die Ausnahme, obwohl es mehr Repräsentation realitätsgetreuer Wut benötigt. Nicht stilisiert, nicht vermarktet – sondern authentisch.
Fazit: Echte Wut – zwischen Leinwand und Lebensqualität
„Is she or isn’t she? – A phoney?“ (00:29:07). Diese Frage aus Breakfast at Tiffany’s bleibt aktuell. Es zeigt sich die Persistenz des gesellschaftlichen Zwangs, einer Idealversion des Geschlechts zu entsprechen.
Die Charaktere in Filmen und Serien wie Barbie, Gone Girl, Killing Eve oder auch Pretty Woman und Breakfast at Tiffany’s wirken auf den ersten Blick feministisch und emanzipiert. Doch diese Stärke ist häufig Teil einer sorgfältig inszenierten Gender Performance, die patriarchale Erwartungen nicht wirklich durchbricht, sondern vielmehr reproduziert. Authentische, rohe Wut wird selten zugelassen; stattdessen wird sie stilisiert, ästhetisiert und so kontrolliert, dass sie weiterhin „erträglich“ bleibt.
Damit zeigen diese Medien zwar einen Fortschritt, aber noch nicht das Endziel. Sie verharren in einer Ambivalenz, die einerseits weibliches Empowerment ermöglicht, gleichzeitig aber verhindert, dass weibliche Wut in ihrer vollen Komplexität und Authentizität sichtbar wird.
Somit wird „female rage“ weiterhin zwischen radikalem Empowerment und kommerzieller Verwertung hin- und hergerissen. Im andauernden Konflikt um die wahre Repräsentation von weiblicher Wut.
Quellen:
- Pretty Woman (1990): Garry Marshall (Regie). USA: Touchstone Pictures.
- Breakfast at Tiffany’s (1961): Blake Edwards (Regie). USA: Paramount Pictures.
- Gone Girl (2014): David Fincher (Regie). USA: 20th Century Fox.
- Barbie (2023): Greta Gerwig (Regie). USA: Warner Bros. Pictures.
- Killing Eve (2018-2022): Phoebe Waller-Bridge (Idee). Großbritannien: BBC America/ Sid Gentle Films.
- El-Mangad, A., & Chakroune, S. (2023). She’s Everything, He’s just Ken: A comprehensive analysis of Barbie (2023). Journal of Gender, Culture and Society, 5(19, 01-11. ISSN 2754-3293.
- Yakali, D. (2024). He is just Ken: Deconstructing hegemonic masculinity in Barbie (2023 movie). Frontiers in Sociology, 9.
- Hetherington, P., Atherton, C., & Miller, A. (2021). Agents of chaos: The monstrous femi-nine in Killing Eve. Feminist Media Studies, online first, 1-17.
- Boehm, M. (2023). Media coverage of Good Girls Revolt from 2015 to 2018: A framing analysis of the feminist program pre- and post-Time‘s Up. Kentucky Journal of Communi-cation, 41(1), 76-99.
- Ruti, M. (2016). Feminist film theory and Pretty Woman. London: Bloomsbury Academic.
- Wilk, K. (2024). Feminist film theory: The impact of female representation in modern mov-ies. Studia Humana, 13(4), 13–22.
- Gülderen, E. (2020). Feminism in Gilian Flynn’s novels: Violence, malice and amorality as the basis of a post-feminist agenda [Masterarbeit, Universität Duisburg-Essen]. DuEPubli-co. https://doi.org/10.17185/duepublico/71787
- Abbott, M. (2018, June 28). Gilian Flynn isn’t going to write the kind of women you want. Vanity Fair. https://www.vanityfair.com


 Pexels
Pexels